Tausend Kilometer Einsamkeit

Auf der Carretera austral nach Feuerland
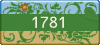
Der Lufthansa-Flug LH526 bringt uns in 12 Stunden von
Frankfurt nach Buenos Aires, der argentinischen Metropole,
die die 11-Millionen-Grenze mittlerweile überschritten haben
dürfte. Da wir der Sonne sozusagen „davonfliegen“, zieht
sich die Nacht in die Länge. Somit ist das Erreichen der
Neuen Welt heute in einer Zeit möglich, wofür die alten
Segelschiffe noch mehrere Wochen benötigten. Ein bißchen
Schlaf werden wir wohl finden, so daß wir die
Zeitverschiebung ganz gut verkraften dürften. Der
nächste Tag dauert dafür einfach nur sechs Stunden länger.
Störender ist da schon das unentwegte Kindergeschrei und der
Geruch des Erbrochenen. Junge Eltern muten ihren Sprößlingen
heute einfach zuviel zu, eine
 bedenkliche Entwicklung
zunehmender Rücksichtslosigkeit gegenüber dem eigenen
Nachwuchs. Aber Kinder stimmen andererseits auch auf
Südamerika ein, sind doch die Einwohner Argentiniens zumeist
italienischer oder spanischer Abstammung.
bedenkliche Entwicklung
zunehmender Rücksichtslosigkeit gegenüber dem eigenen
Nachwuchs. Aber Kinder stimmen andererseits auch auf
Südamerika ein, sind doch die Einwohner Argentiniens zumeist
italienischer oder spanischer Abstammung.
Der Service an Bord wird ebenfalls zusehends schlechter. In
dem Bestreben, Einwegverpackungen zu vermeiden und dadurch
Kosten zu senken, wird die ausgeschenkte Flüssigkeitsmenge
immer weiter reduziert, so daß man, würde man sich nicht
selbst vehement um Trinkbares bemühen, glattweg verdursten
könnte. Die Maschine ist zudem bis auf den letzten Platz
ausgebucht, so daß die Ellbogenfreiheit nicht gerade für
Streckübungen ausreicht.
Als beim Blick durchs Bullauge das Sternbild Orion genau den
Weg nach Süden weist und die ersten Lichter auftauchen, wird
klar, daß wir den Atlantik bereits hinter uns gebracht
haben. Genau bei den Guayanas treffen wir auf die
südamerikanische Scholle. Beim Landeanflug auf Buenos Aires
zeichnet sich ganz deutlich das silbrig schimmernde Band des
Río de la Plata ab, den wir in seiner ganzen Breite
überfliegen, bis sich unter uns die klaffenden
Häuserschluchten auftun, schachbrettartig angelegte
Straßenzüge, mit denen die ganze Stadt durchzogen ist. Es
ist wahrhaftig eine unendlich ausgedehnte Metropole, die
insgesamt 19 Vorstädte einschließt. Allein, von Buenos
Aires bekommen wir nicht viel zu sehen, da es für uns nur
ein Transitaufenthalt ist, dazu angetan, für eine Weile den
Fuß auf festen Boden zu setzen und das Flugerlebnis nicht
allzulang werden zu lassen.
Nach einer halben Stunde Aufenthalt erfolgt ein Aufruf, daß
sich der Weiterflug nach Santiago de Chile aufgrund
technischer Probleme verzögern wird. Alle Passagiere werden
gebeten, ihr Handgepäck aus dem Flugzeug zu räumen. Durch
die Scheiben des Transitraums können wir beobachten, wie
sämtliche Triebwerke abgedeckt werden. Der Schaden scheint
doch gravierender als zunächst angenommen, der Jumbojet muß
auf dem Boden bleiben: Die Passagiere werden auf mehrere
Maschinen der chilenischen Fluggesellschaft LAN umverteilt,
die uns nun in die chilenische Hauptstadt bringt. Der
Service an Bord kann sich jedoch mit dem der Lufthansa nicht
vergleichen. Das Essen würde man bei uns nicht einmal einem
Hund vorsetzen: das Hähnchenfleisch mit einem seltsamen
Beigeschmack, die Butter zerlassen, selbst das Bezier ist in
der Wärme geschmolzen. Dafür hat die Stewardess einen Teint
wie Elfenbein, man muß sie unentwegt ansehen. Tango
Argentino!
Nun beginnt der Flug über die Anden, und wir haben bestes
Flugwetter. Unter uns liegt zunächst noch flache Pampa, von
schnurgeraden Straßen durchfurcht. Die Bewölkung ist recht
aufgelockert, nimmt aber, je mehr wir uns dem Gebirge
nähern, immer mehr zu, jedoch ohne daß sich die Wolkendecke
schließt. Blendend-weiße Cumuluswolken türmen sich zunehmend
zu amboßförmigen Cumulonimben auf, je näher wir an die Anden
herankommen, und unterwegs gewittert es bereits. Nun sieht
man ganz deutlich, daß dieses Gebirge ein Kettengebirge ist,
ohne markante Erhebungen, und nicht wie die Alpen ein
Faltengebirge. Türkisgrüne Seen schimmern unter uns, und als
wir die Stadt Mendoza überfliegen, tauchen sie über den
Wolken auf, die ersten Andengipfel, bizarre Sechstausender,
von ewigem Schnee und Eis gekrönt. Es finden sich Gipfel
darunter, die unsere Flughöhe übertreffen, einsame
majestätische Berggestalten. Und immer wieder schlängelt
sich zwischendurch ein Fluß durch diese karge, zerklüftete
Karstlandschaft, dieses baumlose braune Nichts. Dazu
erklingen aus den Kopfhörern auf Zupfinstrumenten und
Gitarren vorgetragene indianische Weisen, und unter dem
Zwang der Endorphine, bei einem Glas chilenischen Rotweins,
steigern sich unsere Gefühle ins Euphorische. Die
Steilkurve, als wir in die Platzrunde einschwenken,
erscheint jetzt steiler noch als sonst, und wie ein Spuk,
ein kurzer Traum, ist der ganze Zauber wieder vorbei.
Chile besitzt jenseits der Anden, auf der pazifischen Seite,
nur einen schmalen Küstensaum, und die Hauptstadt, Santiago
de Chile, liegt ungefähr auf gleicher Höhe wie Buenos Aires.
Bei unserer Ankunft am späten Nachmittag, infolge der
Verspätung, herrscht strahlend-schöner Sonnenschein. Die
Stadt liegt eingebettet zwischen hohen Gebirgsketten und
nimmt darin die gesamte Hochebene ein. Sie ist
schachbrettartig angelegt, ein Beispiel mehr für die damals
von König Philipp angeordnete koloniale Bauweise.
Riesenhafte Wolkenkratzer dominieren das Stadtbild jedoch
nicht.
Die beste Aussicht hat man vom Cerro San Cristóbal, dessen
höchsten Punkt eine Statue der Jungfrau Maria einnimmt. Den
nicht weniger als 40 Erdbeben seit ihrer Gründung sind fast
alle Kolonialbauten zum Opfer gefallen, so daß die Stadt
sich heute meist im neoklassischen Stil präsentiert, wie er
für den Beginn des 20. Jahrhunderts typisch ist. Der
zentrale Platz Santiagos ist auch heute noch die Plaza de
Armas mit der alles beherrschenden Kathedrale. Hier findet
meist ein bunter Indiomarkt statt. Auch die Moneda, auf
deutsch Münze, ist eines der repräsentativeren Bauwerke. Der
Platz davor gleicht einer Flaniermeile. Zum Fotografieren
ist es heute allerdings schon zu spät, da durch die langen
Schatten aufgrund der exakten Nord-Südausrichtung der
Straßen die Frontseiten der Gebäude nicht mehr hinreichend
beleuchtet werden.
Die Stadt selbst ist sehr sauber, und das Land als solches
ist in Südamerika die Nummer Eins, wenn sich die Frage
stellt, wo das Leben am besten ist. Allerdings wandern immer
mehr Menschen aus Peru und Bolivien ein, so daß es nur eine
Frage der Zeit ist, bis sich das Ganze ausgleicht. Die
Sicherheit in der Hauptstadt ist vor allem nachts
vergleichsweise höher als in den anderen
lateinamerikanischen Staaten, dennoch wird ausdrücklich
empfohlen, Wertsachen nicht erkennbar am Körper zu tragen.
Auf dem Land bzw. in der Provinz sei das Leben noch in
Ordnung, versichert man uns.
Nachdem das wolkenlose Wetter über Nacht angehalten hat,
steht uns ein heißer und aussichtsreicher Fahrtag bevor, auf
der Route 5, besser bekannt unter dem Namen Panamericana,
die leider autobahnähnlich ausgebaut ist. Die Fahrt führt in
nahezu südlicher Richtung über die Städte Rancagua, San
Fernando, Talca und Chillán durch das weite und ebene Tal
zwischen der Hochandenkette und der sogenannten
Küstenkordillere. Es ist dies das Weinbaugebiet Chiles,
aber auch Obst und Getreide gedeihen hier vorzüglich.
Rancagua ist eine Stadt des Rodeos. Hier hat sich der
Berufsstand der sogenannten Huasos etabliert, der sich am
besten durch den Begriff des Cowboys umschreiben läßt.
Allerdings dürfte sich wenig wahre Romantik dahinter
verbergen, denn Huasos wurden als Mädchen für alles
eingesetzt.
Linker Hand eröffnen sich angesichts der guten Fernsicht
immer wieder faszinierende Ausblicke auf einen der
zahlreichen noch aktiven Vulkane, die das Land hat. Zunächst
taucht bei San Fernando der 4100 m hohe Azufre auf, der
aufgrund seiner Höhe im gesamten oberen Drittel
schneebedeckt ist, sodann bei Talca der Descabezado Grande
mit 3830 m und schließlich bei der gleichnamigen Stadt der
nur 3186 m hohe Chillán. Dieses landwirtschaftlich genutzte
Längstal verdankt seine Fruchtbarkeit den zahlreichen
Andenflüssen, die sämtlich dem Pazifik zuströmen, um
schließlich in den kalten Humboldt-Strom zu münden. Der
namhafteste unter ihnen ist der Río Maule, berühmt deswegen,
weil er der
 Grenzfluß war, an dem das Inkareich endete.
Südlich davon lag das Gebiet der Mapuche-Indianer.
Landschaftlich reizvoll ist dieser Abschnitt nicht, da die
Berge zu weit entfernt sind und selbst als Fotomotiv nicht
taugen. Wem dieser Teil Chiles einen Erlebniswert bereiten
soll, der muß sich schon in die andinen Hochlagen vorwagen,
denn schwierig zu bezwingen sind diese Vulkane trotz ihrer
Höhe im allgemeinen nicht. Wir haben uns eine Besteigung
dieser Berge jedoch nicht zum Ziel gesetzt, da dies einen
ungleich höheren Zeitaufwand erfordern würde, als wir ihn
erübrigen können.
Grenzfluß war, an dem das Inkareich endete.
Südlich davon lag das Gebiet der Mapuche-Indianer.
Landschaftlich reizvoll ist dieser Abschnitt nicht, da die
Berge zu weit entfernt sind und selbst als Fotomotiv nicht
taugen. Wem dieser Teil Chiles einen Erlebniswert bereiten
soll, der muß sich schon in die andinen Hochlagen vorwagen,
denn schwierig zu bezwingen sind diese Vulkane trotz ihrer
Höhe im allgemeinen nicht. Wir haben uns eine Besteigung
dieser Berge jedoch nicht zum Ziel gesetzt, da dies einen
ungleich höheren Zeitaufwand erfordern würde, als wir ihn
erübrigen können.
An diesem Abend schlagen wir auf dem Camping-Platz am Salto
del Laja unser Lager auf. Wegen der gerade herrschenden
Urlaubssaison ist die Anlage stark überlaufen. Der Salto del
Laja ist der höchste Wasserfall des Landes, 35 m hoch.
Unbekannt bleibt uns sein Flußlauf. Im Morgenlicht, das in
seiner gewohnten Intensität für viel Farbe sorgt, sieht der
Salto viel plastischer aus als noch gestern abend im
goldenen Abendlicht.
Unsere heutige Etappe führt durch das Land der
Mapuche-Indianer. Diese konnten von den spanischen Invasoren
nie ganz ausgerottet werden. Sie, die Spanier, welche die
Inkas und Guaraní-Indianer unterwarfen, bissen sich an den
Mapuche die Zähne aus. Damit war die Eroberung Chiles nur
mehr eine Frage der Zeit. Der erste Europäer nämlich, der
von Norden her nach Chile eindrang, war Diego de Almagro.
Seine Suche nach Gold blieb jedoch erfolglos, seine
Expedition scheiterte, er selbst mußte sich unter großen
Verlusten wieder nach Norden zurückziehen. Der nächste
Konquistador, der kam, war Pedro de Valdivia. Gegen den
erbitterten Widerstand der Mapuche gelang es ihm, den Ruf
eines Gründers Chiles zu erlangen.
Es leben heute noch ca. 600.000 reinrassige Mapuche in
Chile. Sie sind kleinwüchsig und stämmig, haben hohe
Wangenknochen und eine dunkle Hautfarbe. Ihre Herkunft ist
nicht vollständig geklärt, aber man nimmt an, daß sie aus
dem Süden Argentiniens eingewandert sind und die dort
lebenden Stämme nach Norden abgedrängt haben. Das Reich der
Mapuche, die heutige Provinz Araucanía, betreten wir mit
Überschreiten des Flusses Bío Bío.
Die Mapuche wehren sich hauptsächlich gegen die rigorose
Abholzungspolitik Chiles. Die großen Rodungen der
Vergangenheit versucht man durch großangelegte Aufforstungen
wiedergutzumachen, teils mit einheimischen Pflanzen, teils
mit australischen Eukalyptusbäumen.
Die pyramidenförmigen Araukarien, auch Andentannen genannt,
zählen zu den seltsamsten Bäumen Südamerikas. Ihre Rinde ist
derart dicht mit stechenden Nadeln besetzt, daß selbst ein
Affe nicht daran hochklettern kann. Ihre Samen bilden die
Ernährungsgrundlage der Mapuche-Indianer, die Fruchtstämme
werden auch gerne von Papageien heimgesucht.
Bald gelangen wir in das Tal des Río Malleco, welches von
einem Viadukt überbrückt wird: eines von zahlreichen
Beispielen der Baukunst des Gustave Eiffel in Südamerika.
Gerade in dem Moment fährt ein Frachtzug über die etwa 100 m
hohe Brücke.
Immer wieder tauchen nun in der Ferne vereinzelt Vulkankegel
auf. Es soll insgesamt über zweitausend Vulkane in Chile
geben, von denen 116 als noch nicht erloschen gelten. Auch
der Villarrica geht auf vulkanische Tätigkeit zurück.
Bislang glaubte man, daß die Anden aus einer tektonischen
Plattenverschiebung hervorgegangen seien, nach heutigem
Stand der Wissenschaft sind sie aber als Folge einer Hebung
aufgrund eines Erdbebens entstanden.
Die Vulkankette nimmt und nimmt kein Ende. Plötzlich taucht
in der klaren Luft der Lonquimay auf, mit seiner typischen
Kegelgestalt. Es ist eigentlich viel zu schade, sich diese
Vertreter des größten Naturereignisses unseres Planeten nur
aus der Ferne anzusehen.
Im Laufe des Tages kommen wir nach Temuco. Es ist aus einer
strategischen Festung gegen die Mapuche hervorgegangen. In
der Mapuche-Sprache bezeichnet das Wort Temuco den Namen
eines Baums.
Die Landschaft erinnert schon ziemlich stark an ein
deutsches Mittelgebirge. Temuco besitzt keine spektakulären
Sehenswürdigkeiten, es gibt dort einen Markt, das ist aber
auch alles. Die zahlreichen Restaurants wetteifern
untereinander um die Gäste, und zwar müssen die Bedienungen
sie in anbieterischer Weise für sich gewinnen. Vermutlich
bemessen sich ihre Gehälter daran, wie viele davon sie zum
Bleiben bewegen können. Das kann Formen annehmen, daß man
fast in das eine oder andere Restaurant hineingezogen wird.
Bei Loncoche verlassen wir die Panamericana und biegen ab in
Richtung Villarrica, zum gleichnamigen Vulkan und See, dem
Lago Villarrica. Die Flora und das Landschaftsbild haben
sich bereits stark gewandelt. Mächtige Bäume erinnern an
unsere heimischen Eichenbestände, die Landschaft ist hügelig
geworden wie in Mitteleuropa. Leider ist der zu Füßen des
Villarrica gelegene Touristenort Pucón völlig mit
einheimischen Urlaubern überlaufen. Um in Pucon einen Abend
zu verbringen, bieten sich eigentlich nur die seichteren
Vergnügungen an: Bummeln oder in einer der vielen Kneipen
und Restaurants das gute Kunstmann-Bier zu schlürfen, das
nach deutscher Brauart hergestellt wird, und das, wenn man
zu mehreren ist, in riesigen Bottichen, die etwa dem
Doppelten einer bayerischen Maß entsprechen, serviert und
daraus in kleinere Gläser umgefüllt wird.
Das Lebensgefühl in dieser Stadt ist ein ganz anderes, als
man es in Europa kennt. Die Chilenen sind im Durchschnitt
jünger als 25 Jahre; man sieht auf den Straßen überwiegend
junge Menschen, und dementsprechend unbeschwert läuft hier
das Leben ab. Englisch spricht freilich niemand, ohne
Kenntnisse des Spanischen hat man keine Chance, Kontakte zu
knüpfen. Hier ist alles geboten, was die sportliche Jugend
von einem Aktivurlaub erwartet: Rafting, Kayaking und
organisierte Vulkanbesteigungen. Die geführte Tour auf den
Villarrica dauert 6-8 Stunden und muß mit Seil und Eispickel
durchgeführt werden. Aus dem Krater steigt ständig eine
Rauchsäule auf, und der Blick in das glutflüssige Innere
zeigt, daß wir es hier mit einem gefährlichen Killervulkan
zu tun haben. Da sich der Gipfel in Wolken befindet,
brauchen wir die Möglichkeit einer Besteigung heute nicht
mehr in Erwägung zu ziehen. Das Wetter weiß eben nicht, was
es will: gerade ist eine Warmfront durchgezogen und es sieht
nach Regen aus.
Nachdem sich der Ort am nächsten Morgen wieder im
strahlenden Gewande präsentiert, zeigt sich der Vulkan
wolkenfrei, so daß wir gerne noch länger verweilen würden.
Doch läßt uns dies andererseits darauf hoffen, den Osorno in
ebenso majestätischer Aufmachung anzutreffen. Somit setzen
wir unsere Fahrt fort, auf der Route 5, mit Ziel Valdivia,
das von Pedro de Valdivia 1552 als viertälteste Stadt Chiles
gegründet wurde.
Die uns umgebenden Wälder werden nun dichter. Die Straße
führt an Wasserläufen vorbei, wo sich ganze Seerosenteiche
in voller Blütenpracht zeigen, und nach nicht allzulanger
Fahrt erreichen wir gegen Mittag die Stadt, die in der Nähe
des Meeres liegt und mit regem Treiben aufwartet.
Valdivia liegt abseits der touristischen Routen. Es bietet
nach der Zerstörung durch mehrere Erdbeben nichts
Sehenswertes mehr, außer daß die ursprüngliche Stadtanlage
beibehalten wurde. Einzig ein Festungsturm, der auf die
spanische Eroberung zurückreicht, ist noch von Interesse. Er
wurde in dunkler Ziegelbauweise errichtet und ist von Zinnen
bekränzt.
Von Valdivia aus können Bootsausflüge zu den drei am
Mündungstrichter des Río Valdivia gelegenen spanischen
Bollwerken Corral, Niebla und Nucera gemacht werden, was der
Stadt den Namen „Gibraltar des Südens“ eingebracht hat.
Chile wurde wie gesagt von Diego de Almagro von Cuzco aus
erobert, und als zweiter kam nach dessen Hinrichtung ein
weiterer Kampfgefährte Pizarros, Pedro de Valdivia,
ebenfalls aus der Extremadura gebürtig. War Almagros Vorstoß
noch kaum von Erfolg gekrönt − sein Zug über die Anden
artete in eine Katastrophe aus −, so war Valdivia
erfolgreicher. Auf dem Marsch entdeckten die Spanier ihre
während der ersten Expedition im Schnee zu Eissäulen
gefrorenen Gefährten, mit im Ausdruck des Todeskampfs
erstarrten Gesichtern, teils noch auf ihren Pferden sitzend
und Lanzen tragend. Der Schnee- und Kälteeinbruch muß für
das zurückgesandte Expeditionschorps Almagros völlig
überraschend gekommen sein. Dieser Anblick verbreitete in
Valdivias zweitem Expeditionsheer, das auf dem gleichen Wege
gekommen war wie ihre auf diese Weise umgekommenen
Gefährten, Entsetzen.
Valdivia sollte kein schönerer Tod beschieden sein. Nach
anfänglichen Erfolgen gegen die Mapuche-Indianer − seinen
erbittertsten Gegner fand Valdivia in Häuptling Lautaro −
wurde er, nachdem sein Pferd von einer Lanze getroffen
worden war, in der Schlacht von Tucapel gefangengenommen und
von den Mapuche-Indianern in drei Tagen Stück um Stück
aufgefressen. Der Mapuche-Häuptling Laurato fiel später im
Kampf gegen die Spanier, sein Nachfolger Caucopán wurde nach
seiner Ergreifung zu Tode gefoltert. Die spanischen
Eroberungsfeldzüge nördlich des Bío-Bío-Flusses waren 1562
abgeschlossen, wenngleich der Unabhängigkeitskampf der
Araukarier sich noch bis 1882 fortsetzte.
Als Nachtlager haben wir uns diesmal einen Campingplatz in
der Region am Llanquihue-See ausgesucht. Das Wasser des Sees
ist eisig kalt, aber wir schrecken dennoch nicht vor einem
erfrischenden Bad zurück. Gegenüber ragt der Vulkan Osorno
in den Himmel, dessen Krater von einer dicken Eisschicht
überzogen ist.
Der Osorno ist ein Schicksalsberg. Vielen, selbst erfahrenen
Bergsteigern sind die äußerlich nicht sichtbaren
Gletscherspalten schon zum Verhängnis geworden.
Prominentestes Opfer ist der Münchner Expeditionsleiter
Hauser.
Das Gebiet um Osorno wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von
Deutschen besiedelt, deren handwerkliche Fähigkeiten in dem
Land besonders geschätzt waren. Wenn man die
schindelgedeckten und verkleideten Häuser sieht, glaubt man
sich bisweilen in den deutschen Alpenraum versetzt. Die Art,
Gehöfte und Scheunen zu gruppieren, ja selbst die Art der
Bepflanzung sind typisch deutsch. In den Cafés werden
deutscher Kuchen und Bohnenkaffee gereicht, womit man sich
auch in bezug auf das leibliche Wohl ganz wie zu Hause
fühlt. Menschen vom deutschen Schlage lassen sich allerdings
nur mehr wenige ausfindig machen, daß sie Inzucht betrieben
hätten, kann man ihnen gewiß nicht vorwerfen. In den gut
hundertfünfzig Jahren werden sich wohl die meisten von ihnen
mit Latinos assimiliert haben, und ihre Muttersprache haben
sie nahezu alle verlernt. Es gibt ein trauriges Bild von den
Deutschen ab; wohin sie auch kommen, ob als Franken nach
Frankreich, als Goten nach Italien oder Spanien, als
Wolgadeutsche, Siebenbürger Sachsen oder Banater Schwaben
nach Rußland, Rumänien oder Ungarn, überall haben sie sofort
die fremde Kultur angenommen. Das spricht eher für eine
gewisse Anpassungsfähigkeit bis hin zur Unterwürfigkeit,
aber für wenig Identität. Und auch
heute
wieder eignen sie sich fremdes Volksgut an und verwerfen das
eigene.
Osorno liegt in der Provinz Lagos, der vielen Seen wegen so
genannt, die diese Region ausweist. Gegründet wurde die
Stadt im Jahre 1558 von dem spanischen Konquistador García
Hurtado de Mendoza.
Unser Campingplatz in Frutillar liegt in einer ländlichen
Gegend, und wie bei uns haben die Reichen und Begüterten
ihre Villen und Gutshäuser auf dem Hochufer des Sees gebaut.
Eine staubige Straße führt hinauf zu den abgeholzten Hügeln
über dem Llanquihue-See. Viele der ehemals deutschen
Estancia-Besitzer haben sich auf Viehzucht oder
Pferdehaltung verlegt, auch Lamas werden von manchen
gehalten. Wäre da nicht die fremdartige Flora, die ähnlich
der heimischen ist, aber dennoch verschieden, könnte man
sich komplett wie zu Hause fühlen.
Wen es abends nicht in das von deutschen Immigranten
geprägte Städtchen zieht, der kann in der untergehenden
Sonne, um einen Hauch von Freiheit zu atmen, eine Wanderung
am Steilufer des Sees unternehmen, wobei er immer wieder
aufs neue reizvolle Anwesen findet, mit großen Grundstücken
rundherum.
Schon seit einer Stunde habe ich mich aufgemacht, um in der
abendlichen Stimmung noch einen Ausblick auf den Vulkan zu
erhaschen, darauf hoffend, daß durch die Gunst der Stunde,
und sei es auch nur für einen Augenblick, die Wolkenfetzen
aufreißen und mir ein gnadenreicher Anblick wenigstens eines
der beiden Bergriesen vergönnt ist, denn, so denke ich mir:
Kommt der Vulkan nicht zu mir, so komme ich eben zu ihm. Und
wie es der Zufall will: Hinter einem Verkehrsschild
„Achtung! Stiere“ wage ich meinen Augen nicht zu trauen. Als
wäre soeben ein Vorhang aufgezogen worden, ragt plötzlich
der Vulkan Calbuco in den blaß-blauen Himmel, noch
unausgeschlafen und von Nebelfetzen flankiert, jedoch
deutlich erkennbar, mit gratigen Firnfeldern, die von ihm
herabzuströmen scheinen. Die sich zu seinen Füßen
ausbreitende Landschaft könnte sich ebensogut irgendwo in
der Schweiz befinden: die Kühe, die Weiden, die alles
überragenden Baumriesen und das satte Grün erwecken
heimische Gefühle.
Als der Mond sich mit silbernem Licht auf den See legt und
das fremdartige Quaken der Frösche in dem moorig-schwarzen
Wasser tief unter mir sich immer mehr steigert, wird mir
unheimlich zumute, das näherkommende Bellen der Hunde treibt
mich zurück ins Camp. Und als ich dieses erreiche, steht
hoch über mir das Kreuz des Südens, umrahmt von
Schäfchenwolken, d.h. daß es morgen regnen wird.
Das Gebiet um den Lago Llanquihue wird von mindestens drei
großen Vulkanen dominiert, deren prominentester der 2652 m
hohe Osorno ist. Er gilt wegen seiner Ebenmäßigkeit als das
Idealbild eines Vulkans schlechthin und ist der ganze Stolz
der Chilenen. Wenn er an wolkenlosen Tagen sein Antlitz
zeigt, mit weißgekrönter Spitze, im lichten Blau des
Andenhimmels auf der anderen Seite des Sees aufragt, ist
dies bereits ein bewegender Anblick, doch wird man seiner
ganzen Majestät erst dann teilhaftig, wenn man sich zu
seinen Füßen begibt, am besten an die Gestade des
Allerheiligensees, des Lago de los Santos. In diesem
urwüchsigen Tal, das von den tosend grünen Wassern des
Petrohué-Flusses ausgefurcht wird, bietet sich die beste
Gelegenheit, sich an ihn heranzutasten. Bei den reizvollen
Petrohué-Wasserfällen können zur rechten Zeit am rechten Ort
spektakuläre Bilder gelingen. Über zahlreiche jüngere
Lavaströme hinweg, zu feinem Staub zerfallener Asche, muß
man stapfen, um sich diesem allseits von hohen Wänden
umgebenen See zu nähern. Charles Darwin hat den letzten
Ausbruch des Osorno in Worten festgehalten, seitdem
schlummert der überzuckerte Riese.
Regenwaldgleich ziehen sich die mächtigen Baumriesen der
gemäßigten Zonen die schwarzen Hänge hinauf, und wer könnte
da der Herausforderung widerstehen, den Gipfel im Sturm zu
erobern. Doch über der schwül-heißen grünen Hölle will die
Wolkendecke nicht weichen, die den Berg gefangenhält. Nur
zusammen mit erfahrenen Bergführern darf der Vulkan
überhaupt in Angriff genommen werden, der zahlreichen
tückischen Gletscherspalten wegen. Eine Genehmigung für eine
Besteigung, die angeseiltes Gehen mit Eispickel und
Steigeisen erfordert, wird für den heutigen Tag ohnehin
nicht mehr erteilt, zu unsichtig und unstet sind die
Witterungsverhältnisse.
Die mächtigen Alerce-Wälder, der Andenhirsch, die
schneebedeckten Vulkane, sie prägen das großartige Bild
dieser Landschaft, und es bedarf einigen Glücks in diesem
regenreichen Gebiet, wolkenlosen, die Sinne berauschenden
Himmel vorzufinden. Auch uns ist nur ein kurzer
paradiesischer Moment vergönnt, und wir müssen zunehmend den
Augenblick genießen, um von den Launen des Wetters nicht in
tiefe Depressionen gestürzt zu werden.
Am See von Petrohué machen wir Bekanntschaft mit einer
Fliegenart großer schwarzer und stechender Fleischfliegen,
die uns in unzähligen Geschwadern förmlich überfallen und
derer man sich nicht erwehren kann; denn wie bei einer Hydra
kommen desto mehr nach, je mehr man ihrer erschlägt. Diese
unerträgliche Plage treibt uns schnell wieder ins Fahrzeug
zurück, so daß wir froh sind, daß wir den Ort hinter uns
gebracht haben. Es grenzt schon an ein Martyrium, wenn man
sich immer wieder auf die sonnengerötete Haut schlagen muß,
um sich der Plage zu entledigen, man kommt sich vor wie ein
sich geißelnder, mittelalterlicher Flagellant.
Über Puerto Varas gelangen wir am nächsten Tag weiter auf
der Panamericana an den Fährhafen Chacao, wo wir in einer
halben Stunde auf die Insel Chiloé übersetzen, die bereits
1567 von Martín Ruiz de Gamboa für Spanien in Besitz
genommen wurde. Letzterer gründete noch im selben Jahr die
Hauptstadt Castro, die später zum Schlupfwinkel
holländischer Piraten mutierte. Wegen des hier herrschenden
großen Tidenhubs von 7 m haben die ersten Siedler, Stauer,
Bootsführer und Schiffszimmerleute, ihre Behausungen, die
sogenannten Palafitos, auf Stelzen errichtet. Das erst viel
später gegründete Ancud, wo wir heute übernachten, war erste
Anlaufstelle für Schiffe, die Kap Hoorn umrundeten. An den
beiden Bastionen von San Antonio scheiterte 1820 der in
chilenischen Diensten stehende britische Vizeadmiral Lord
Cochrane.
In dem örtlichen Museum, das noch im Aufbau begriffen ist,
werden steinerne Abbilder der mythologischen Gestalten der
Huilliches, der chilotischen Urbevölkerung, ausgestellt. Mit
dieser Mythologie halten die hier lebenden Mapuche-Stämme
die Erinnerung an die Seebeben wach, die verwüstenden
Hurrikane und sintflutartigen Flutwellen, die in der
Erdkruste durch das Versinken des chilenischen Längstals
während der eiszeitlichen Kollision zwischen der ozeanischen
Nazca-Platte und der Kontinentalplatte auftraten. Das
chilenische Längstal ist ein Grabenbruchsystem und erstreckt
sich südlich des Río Aconcagua.
Melipulli, „Ort mit den vier Hügeln“, nannten die Mapuche
die Siedlung Puerto Montt an der geschützten Bucht, an der
sich 1852, als der preußische Abenteurer Bernhard Philippi
in diese Gegend kam, erst 30 Häuser befanden. Damals war die
Umgebung mit ihren fischreichen Gewässern noch von dichten
Urwäldern bestanden, die im Laufe von nur drei Generationen
zu dem wurden, was sie heute sind.
Es gehört nahezu zum Pflichtprogramm eines jeden Reisenden,
der bis hierher vordringt, sich von den winkenden Köchinnen
in eines der zahlreichen Fischrestaurants ziehen zu lassen,
um dort die kulinarischen Köstlichkeiten des Meeres zu
genießen, zu denen der ausgezeichnete chilenische Weißwein
am besten mundet. Wer lieber nostalgischen Träumen
nachhängt, der ersten Besiedlungszeit, der möge sich in den
Club Aleman begeben, um in stilvoller Einrichtung eines der
deutschen Biere oder echten Wiener Bohnenkaffee zu genießen,
den es in Chile nicht so oft gibt. Für uns ist Puerto Montt
zugleich das Sprungbrett zur Carretera austral, denn der
Fährhafen ist Einschiffungsort zur noch weitgehend
unerschlossenen Küste, die sich südlich davon erstreckt.
Als es Abend geworden, legt unsere Fähre in Puerto Montt ab.
Da nicht ausreichend Sitzplätze in den Aufenthaltsräumen zur
Verfügung stehen, muß ein Teil von uns im Fahrzeug
sitzenbleiben. An tiefen Schlaf ist dabei nicht zu denken,
auch ein Bordrestaurant gibt es nicht, also muß jeder
verzehren, was er sich selbst mitgebracht hat. Außer uns ist
da noch ein ganzer Bus mit Trekking-Touristen an Bord, die
fast die ganze Nacht in Ausgelassenheit zubringen. Es sind
Australier und Holländer, die überwiegend alleine reisen,
aber auch andere Angelsachsen sind mit von der Partie. Das
Interesse der Geschlechter aneinander scheint jedoch nicht
besonders groß zu sein, denn trotz der aufreizenden Tänze
und unter dem Einfluß des Alkohols kommt es zu keinerlei
Austausch von Zärtlichkeiten unter den jungen Leuten. Zu
britisch, zu puritanisch, diese Gesellschaft!
Als es in der Nacht aufklart, suchen wir den südlichen
Sternenhimmel gezielt nach Sternbildern ab, doch können wir
außer dem Kreuz des Südens keine weiteren Konstellationen
ausmachen, was nicht zuletzt am Vollmond liegt, der den
ganzen Himmel überstrahlt.
Nach etwa elfstündiger Fahrt bei kaum bewegter See legt
unser Schiff im Morgengrauen in Chaitén an, dessen Hausberg,
der majestätische Vulkan Corcovado, sich in Wolken hüllt.
Das Gebiet ringsum ist eines der regenreichsten
Niederschlagsgebiete der Erde, es kann hier an bis zu 360
Tagen im Jahr regnen. Hier beginnt die Carretera austral,
beginnen 1000 km Einsamkeit. Diese bis auf die ersten 8 km
ungeteerte Straße ließ Pinochet anlegen, und sie diente
ur-sprünglich dem Militär als Verbindungsstraße mit
Patagonien, welches in Chaitén beginnt. Längs dieser zu
Berühmtheit gelangten Trasse ziehen sich zum Teil noch
völlig unerschlossene Wälder hin, die noch nie ein Mensch
betreten hat. Von den zahlreichen Gletschern plätschern
ebenso zahlreiche Wasserfälle herab. In den Wäldern gibt es
noch die vor dem Aussterben bewahrten Alercien, Südbuchen
und riesige Farnblätter.
Die Berge hüllen sich den ganzen Tag in undurchdringliche
Nebel, es gießt wie aus Eimern, und der Boden ist morastig.
Man ahnt die Entrücktheit dieser Natur. Bis Coihaique wird
uns nun die Carretera austral begleiten, und es gibt auf
diesem Abschnitt nichts, was einem das Leben angenehmer
macht, keine Orte, keine Geschäfte, keine Unterkünfte, man
ist mit sich und der Natur allein.
Bei den Thermen von Amarillo, die dem Vulkan Michinmahuida
ihr Dasein verdanken, nutzen wir eine 2stündige Rast zu
einem entspannenden Bad in dem fast 40 Grad warmen Wasser.
Allein der Vulkan, er zeigt sich nicht. Im heißen Naß
sitzend, tröpfelt von oben der kalte Regen auf uns herab.
Abseits des Weges liegt das Wrack eines alten Flugzeugs, das
hier zu einer Notlandung gezwungen war.
An fremden und seltsamen Pflanzen ist die Natur überreich,
und aus der Ursprünglichkeit erwachsen dem Menschen neue
Kräfte. Plötzlich wird es heller und es zeigt sich die
Sonne, die dampfenden Nebel, sie lichten sich, die Geräusche
von Wind und Wasser, es sind die einzigen hörbaren Laute.
Der gehetzte Mensch der Großstadt sehnt sich bisweilen nach
der Einsamkeit der Wildnis. Wenn er sich dann aber in ihr
befindet, muß er feststellen, daß sie doch nicht sein
Lebensraum ist, weil sie zu unerschlossen ist. Dies ist ihm
zumindest dort, wo Flora vorhanden ist, ein Hemmnis, denn
Unwegsamkeit, undurchdringliches Gestrüpp, ein tiefer Bach,
morastiger Boden oder unbegehbare Wälder schränken seine
Bewegungsfreiheit erheblich ein. Somit wird die Freiheit zur
Fessel, so wie hier auf der Carretera austral, wo einzig
eine schmale Schotterstraße den Hin- und Rückweg darstellt.
Was nicht an dieser liegt, bleibt unerreicht.
Am türkisgrünen Yelcho-See schlagen wir unser Lager auf.
Hier ist ein Anglerparadies, und die schwersten Lachse, die
jemals gefangen wurden, hat man aus diesem See gezogen.
Freilich läßt die Landschaft trotz ihrer Üppigkeit und ihres
Artenreichtums aus der Ferne nicht erkennen, daß wir uns in
Chile befinden, zu ähnlich sind diese Fluren den unsrigen;
und
 wenn es nicht gelingt, etwas Typisches auf den Film zu
bannen, wird der unbefangene Betrachter denken, er befinde
sich irgendwo in den Alpen. Auch die Gletscher der Umgebung
sind mächtiger noch in den heimischen Bergen zu finden, als
daß diese uns aus der Bahn werfen könnten. Das Licht
allerdings ist noch um einiges klarer als irgendwo sonst in
Europa, zumal sich auch das Ozonloch bis nach Patagonien
erstreckt. Vorsicht im Umgang mit der Sonne ist also
dringend geboten, zu intensiv ist diese für die empfindliche
und nicht vorgebräunte Haut.
wenn es nicht gelingt, etwas Typisches auf den Film zu
bannen, wird der unbefangene Betrachter denken, er befinde
sich irgendwo in den Alpen. Auch die Gletscher der Umgebung
sind mächtiger noch in den heimischen Bergen zu finden, als
daß diese uns aus der Bahn werfen könnten. Das Licht
allerdings ist noch um einiges klarer als irgendwo sonst in
Europa, zumal sich auch das Ozonloch bis nach Patagonien
erstreckt. Vorsicht im Umgang mit der Sonne ist also
dringend geboten, zu intensiv ist diese für die empfindliche
und nicht vorgebräunte Haut.
Der am Lago Yelcho beginnende Abschnitt der Carretera
austral führt durch unbewohnte Abschnitte, bergauf, bergab,
vorbei an smaragdgrünen Seen, tosenden Wildwassern, und
immer wieder wartet die Natur mit einer Überraschung auf, in
Form bis zum Regenwald herabreichender Gletscher. Ein
regelrechter Panoramablick tut sich am Zusammenfluß des Río
Frío mit dem Río Palena auf, dem wir fürs erste folgen. Tief
eingebettet liegt der Lago Risopatrón unter uns. Hier
gedeihen Fuchsien, riesige Farne, weißer und blauer
Fingerhut und immer wieder Bambus. Die Nalca-Blätter
erreichen unter dem Einfluß der äußerst ergiebigen
Niederschläge Durchmesser, so groß wie Sonnenschirme. Ihr
Stengel wird ähnlich wie unser Rhabarber zu einem Kompott
verarbeitet.
Die Carretera befindet sich gerade im Zustand des Ausbaus.
Viele der ehemaligen Holzbrücken werden durch Betonbrücken
ersetzt, die ursprünglich einspurige Trasse wird Zug um Zug
zu einer zweispurigen Teerstraße verbreitert. Zahlreiche
Felssprengungen haben der einstigen Urwaldromantik ein Ende
bereitet.
Bald erreichen wir den deutschen Vorposten Puyuhuapi, wo
sich der deutsche Emigrant Hopperdietzel niedergelassen hat.
Der Puyuhuapi-Kanal ist in Wirklichkeit ein langgezogener
Fjord, hinter der Insel auf der gegenüberliegenden Seite
beginnt der Pazifik. Als sich nach der letzten Eiszeit die
Gletscher zurückzogen und der Meeresspiegel anstieg, füllten
sich die vom Eis tief ausgeschürften Täler mit Wasser und
ließen die Fjorde entstehen.
Dann schlängelt sich die Straße in zahlreichen Serpentinen
eine Paßhöhe hinauf. Zu dem auf deren Südseite liegenden
Wasserfall Salto del Cóndor führt ein angelegter Pfad durch
den Regenwald. Hier kann man die ganze Kraft einer sich
unbändig gebärdenden, wilden Natur bestaunen. Blühende
Epiphyten wachsen die Bäume hinauf, im Wetteifer mit dichten
Moospolstern. Schlingpflanzen und Farne wuchern aus dunklen
Moortümpeln, und immer wieder wird unseren Weg von
glasklaren Bächen durchschnitten. Nirgendwo ist das
Wechselspiel von Geburt und Tod so eng miteinander
verflochten wie hier, wo der Kampf ums Licht die
vorherrschende Regung ist. Nur selten erhascht man einen
Blick auf die schneebedeckten Gipfel, und zuweilen schimmert
es bläulich aus den Gletscherzungen hervor. Noch harren
zahlreiche Gipfel in den unzugänglichen Regionen, die am
einfachsten per Hubschrauber zu erreichen sind, ihrer
Erstbegehung.
Jenseits des Passes folgen wir dem Durchbruchstal des Río
Cisnes, hinab zum türkis schimmernden Lago Las Torres. Hier
begegnen wir zwei Deutschen, die im Trabbi durch Südamerika
reisen. Ein anderer Deutscher, dem wir begegnen, erzählt
uns, daß El Niño dieses Jahr die südlicheren Striche
heimgesucht habe; daher würden die Fischer Chiles sich
freuen, während die in Peru leer ausgingen. Ob diese These
richtig ist und die heftigen Niederschläge mit El Niño zu
tun haben, muß angesichts der weltweiten Veränderungen
bezweifelt werden, weil nahezu keine Gegend auf der Erde von
heftiger werdenden Unwettern ausgespart bleibt.
Am Lago Las Torres ereilt uns das Schicksal eines
dramatischen Schlechtwettereinbruchs. Die Nacht bereitet
einem Weiterkommen vorerst ein Ende, so daß wir am Ufer des
Sees nächtigen müssen. Es regnet derart in Strömen, daß ein
Verlassen des Fahrzeugs nur unter Inkaufnahme einer
gründlichen Durchnässung möglich ist. Zudem sinkt man im
aufgeweichten Boden so stark ein, daß selbst das
strapazierfähigste Schuhwerk irgendwann durchnäßt ist. Da
hilft nur eins: sich schlotternd am Rande der Straße
schlafen zu legen und den vorbeifahrenden Fahrzeugen kein
Gehör zu schenken. In der Nacht fegt uns der böige Wind, der
sich draußen auf dem See zu regelrechten Windhosen ausweitet
und das Wasser in die Höhe peitscht, förmlich die Plane vom
Zelt. Dann reißen kurzfristig die Wolkenfelder auf und
setzen am kältestarrenden Himmel die Sterne in Gang – sofern
man sich der Illusion hingibt, daß die Wolken festgehalten
werden.
Am nächsten Morgen ist die Schneegrenze in fast greifbare
Nähe gerückt, doch hat der See seine Wärme noch nicht
abgegeben, so daß man in ihm baden kann. Nach einem im
Stehen eingenommenen Frühstück setzen wir unsere
gespenstische Fahrt fort, bei unsichtigem, tristem Wetter,
wolkenverhangenem Himmel, der nur gelegentlich den Blick auf
eine der majestätischen Berggestalten um uns herum freigibt,
vorbei an schäumenden Wasserfällen. Steile schwarze
Felswände, vor denen selbst die Vegetation nicht haltmacht,
ragen beiderseits der Straße auf, und parallel zu dieser
fließt der grüne Simpson-Fluß, der uns bis Puerto Aysén
begleitet.
In dieser Gegend haben sich viele Briten angesiedelt, die
seit jeher an rauhes Klima gewöhnt sind, und sie harrten
hier aus, einer mageren Milchwirtschaft trotzend.
Die Spuren der Brandrodung, die in den 40er Jahren den
Waldbeständen in den Tälern ein Ende bereitet hat, sind
immer noch nicht beseitigt, der Raubbau an der Natur hat
unübersehbare Folgen hinterlassen. Baumstamm liegt neben
Baumstamm, so wie sie fielen, schwarz, versteinert, ohne
schützendes Moos. Ihr wertloses Holz kann bestenfalls als
Brennmaterial dienen.
Telegraphenleitungen und Weidezäune aus Stacheldraht
begleiten uns, geben der Natur ein gänzlich entstelltes
Aussehen. Schön ist diese Hinterlassenschaft nicht, und was,
frage ich mich, hat eigentlich der Mensch hier verloren? In
seiner unersättlichen Gier raubt er alles, rottet alles aus,
vernichtet Art um Art, bis er schließlich selbst ein immer
erbärmlicheres Dasein fristet.
Der Ort Coihaique, den wir bald erreichen, beeindruckt durch
einen Kletterfelsen von gewaltigen Ausmaßen, der sich
zyklopenartig über der Stadt erhebt. Zwei der benachbarten
Berge tragen die zutreffenden Namen Kastor und Pollux. Die
Leute von Coihaique nennen diese Steinformationen
spaßeshalber die „Chinesische Mauer“.
In Coihaique verabschieden wir uns von der Carretera austral
und brechen auf in Richtung argentinischer Grenze, durch
eine majestätische, baumloser werdende Landschaft. In der
weiten Pampa gedeihen noch Schafgarbe und Kamille, die heute
hier vorzufindenden Pinienwälder lieben indes die
Trockenheit.
Über gerodete Fluren nähern wir uns der Grenze bei Balmaceda
am Paß Huemules. Bei der Grenzabfertigung wird streng darauf
geachtet, daß keine verderblichen Lebensmittel eingeführt
werden. Die Provinz Chubut, in die wir nun einreisen, ist
die drittgrößte Argentiniens. Magellangänse, Chile-Enten und
Flamingos bestimmen ab jetzt die Fauna. Nach einer Stunde
Fahrtzeit findet sich kein Baum mehr, soweit das Auge
reicht. Dagegen sind die Lüfte bevölkert von Chimangos,
einer Raubvogelart. In dem tierarmen Patagonien trifft man
allenthalben auf Füchse, Kaninchen, Guanakos und Nandus. Das
scheue und schwer zu entdeckende Gürteltier wird immer
seltener, und es hebt sich nur schwer von seiner Umgebung
ab, da es farblich exakt dem Untergrund angepaßt ist. Auch
Stinktiere soll es hier geben.
Patagonien umfaßt den Teil Argentiniens südlich des Río
Colorado. Die Landschaft ist recht eintönig, das Land
ziemlich arid, da es im Regenschatten des Gebirges liegt.
Aufgrund des ständig wehenden Windes gedeihen hier nur
Büschelgras und Sauerampfer. Der Name Patagonien, d.h. „Land
der Großfüßer“, wurde von Ferdinand Magellan vergeben, weil
die dort lebenden Tehuelche-Indianer Fußabdrücke
hinterließen, die von den Spaniern als groß empfunden
wurden.
Bisweilen ändert die patagonische Steppe ihr Antlitz in eine
Wüste, wenn sich die niederen Grasbüschel in der Ferne
verlieren. War es anfangs der Regen, der uns überreichlich
beschert wurde, ist es nunmehr der lungenfüllende Staub,
gegen den wir anzukämpfen haben.
Die Flüsse Patagoniens, sie entspringen allesamt den
Gletschern der Anden und haben wie die Seen eine
milchig-weiße Farbe. Der Lago Blanco, der Weiße See, liefert
hierfür ein erstes Beispiel.
Obwohl noch Wolken am Himmel sind, ist das Wetter nun
überwiegend sonnig geworden, und das Himmelsblau ist von
einer ausgesuchten Klarheit, wie man sie nur auf der
südlichen Hemisphäre kennt.
Vorbei an der Estancia Huemules und am Lago Blanco, führt
die Fahrt zunächst ostwärts, bis wir auf die in
Nord-Südrichtung verlaufende Route 40 stoßen, der wir
südwärts bis Perito Moreno folgen. Der Ort ist aber nicht zu
verwechseln mit dem Gletscher Perito Moreno, der einige
hundert Kilometer südwestlicher liegt.
Durch die Weiten der patagonischen Steppe führt die Fahrt,
endlos monoton, bis wir schließlich wieder in die Nähe der
Andenkette kommen. Die Auswirkungen des im Jahre 1991
ausgebrochenen Hudson-Vulkans (1905 m) waren bis in diese
Gegend zu spüren, was viele der hier lebenden
Großgrundbesitzer dazu zwang, ihre Estancias aufzugeben.
Denn die Menschen auf den Estancias leben hauptsächlich von
der Schafzucht.
Bekanntlich grast das patagonische Schaf auf Weiden, die
ganz anders sind als andere Weiden, und deshalb ist
argentinisches Lammfleisch mit keinem anderen der Welt zu
vergleichen. Dementsprechend dominiert in der argentinischen
Küche eindeutig das Cordero, und wer in Patagonien war und
kein Cordero gegessen hat, war eigentlich nicht in
Argentinien. Obwohl das Land die „Fleischfresser“-Nation
Nummer eins ist, kann sich heute kaum eine argentinische
Familie öfter als einmal im Monat Fleisch leisten.
Als Getränk wird dazu hauptsächlich Mate-Tee gereicht, das
Nationalgetränk Argentiniens. Er wird von einem sogenannten
„Zeremonienmeister“ zubereitet und aus der Kalebasse
getrunken. Zur Verbreitung der Mate-Kultur haben unter
anderem die Jesuiten beigetragen.
Von Perito Moreno setzen wir die Fahrt auf der Route 40
fort, durch die Provinz Santa Cruz, durch die endlosen
Weiten der patagonischen Steppe, bis in das Gebiet von Tres
Lagos.
Am Río Pinturas hat man in der Höhle von Las Manos die
ältesten Felsmalereien Südamerikas gefunden, die in die Zeit
bis 9500 v. Chr. datieren. Das Valle Pinturas, das „bemalte
Tal“, zeichnet sich aufgrund der unterschiedlichen
Farbgebung seines Gesteins an landschaftlicher Schönheit
aus. Die Winderosion hat hier spektakuläre Formen
hervorgebracht. Das ganze Gebiet ist vulkanischen Ursprungs,
und ein in der Ferne herausragender Tafelberg, ein
erloschener Vulkan, bleibt auf lange Sicht unser einziger
Begleiter.
Zu Füßen des 3706 m hohen Monte San Lorenzo liegt der
berühmte Nationalpark Perito Moreno, abseits unserer Route;
um aber dahin zu gelangen, bräuchte man eine bessere
Ausrüstung, als wir sie mitführen. Dorthin kommen auch
wirklich nur bewundernswerte Idealisten. Wir indes haben nur
ein Ziel: auf dem Landweg Feuerland zu erreichen, und wir
schrecken dazu auch vor überlangen Tagesetappen nicht
zurück.
Unterwegs stoßen wir auf ein liegengebliebenes Fahrzeug,
welches einer Gruppe israelischer Touristen gehört, denen
der Treibstoff ausgegangen ist. Wäre es nach mir gegangen,
so hätte ich ihnen in dieser Situation nicht geholfen, nicht
etwa, weil ich ihre Siedlungspolitik mißbillige, sondern
weil Liegenbleiben infolge Treibstoffmangels in dieser
unwirtlichen Gegend ein unverzeihlicher Fehler ist, der
gebührend honoriert werden sollte.
Im Gebiet von Perito Moreno entspringt der Río Chico, dessen
Verlauf wir ein gutes Stück folgen. Er mündet bei der großen
Sandbank von Puerto San Julián in den Atlantik. Hier ankerte
Ferdinand Magellan drei Monate lang, um zu überwintern.
Dabei kam es zu einer Meuterei unter seinen spanischen
Kapitänen, die sich dem Oberkommando eines Portugiesen nicht
unterwerfen wollten. Magellan setzte die Verschwörer ohne
Wasser und Nahrungsmittel kurzerhand aus.
Immer wieder kommen wir nun an aufgegebenen Estancias
vorbei, deren Besitzer dem bequemeren Leben in den
Großstädten den Vorzug vor dem beschwerlicheren in der
Landwirtschaft einräumten. Als es Abend wird, taucht
überraschend hinter einer Kuppe der gewaltige Lago Cardiel
auf, der erste von drei Seen, denen das Gebiet von Tres
Lagos seinen Namen verdankt. Die beiden anderen sind der
Lago San Martín und der Lago Viedma. Die smaragdgrünen
Wasser des Lago Cardiel und seine Lage, eingebettet in eine
grenzenlose Einöde, können wahres Entzücken hervorrufen.
Die Landschaften Patagoniens sind vielfältiger, als man
gemeinhin glaubt, wenngleich monotone Landstriche
überwiegen. Doch auch Flußläufe, Canyons und vereinzelte
isolierte Berge bieten willkommene Abwechslung. Außer an den
Flußläufen, im Bereich der Estancias, findet sich kein
natürlich wachsender Baum, zu windig, zu trocken, zu kalt
und staubig ist die Erde, um deren Existenz je zuzulassen.
In überschwenglichen und ausdrucksstarken Worten schilderte
Charles Darwin Patagonien und seine Bewohner, die natürlich
nicht anders sein können als die sie umgebende Natur: karg
und verschlossen. Wir an unser mitteleuropäisches Klima
Gewohnten können es kaum aushalten in dem ständigen Wind,
der andauernden Kälte, so daß sich die berechtigte Frage
stellt, wie die Immigranten sich hier wohlfühlen konnten.
In der Ferne gehen ergiebige Regenschauer nieder, obwohl
zumeist die Sonne durch die Wolkendecke dringt und sich
zwischendurch immer wieder zartblauer Himmel zeigt. Da sich
eine bedrohliche Wolkenfront über uns aufbaut, beschließen
wir weiterzufahren und trockenere Gefilde aufzusuchen. Auch
treibt der patagonische Wind die Wolken in Fetzen über uns
hinweg, so daß wir unser Essen wohl kaum im Freien einnehmen
könnten, ohne Gefahr zu laufen, daß uns die Wurst vom Brot
gefegt wird.
Die Wolkenbilder Patagoniens sind lebhafter als irgendwo
sonst. Meist wirkt der Himmel chaotisch, ein Gemisch aus
quellweiß-geballten Cumuluswolken, die sich mit Staub
vermengen und über denen sich eisige Cirren in nie gesehener
Form ausbreiten. Über dem patagonischen Eisschild bilden
sich häufig auch Lenticularis-Wolken aus, deren Ränder in
allen Regenbogenfarben schillern.
Das harte Ichu-Gras, welches man im Altoplano so häufig
findet, ist eines der zahlreichsten Gräser der Region, doch
auch das rötliche Fuchsschwanzgras ist kaum zu übersehen.
Die hellen Magellanstengel gedeihen hier in unüberschaubarer
Fülle. Eingestreut wie in ein Feld finden wir immer wieder
Teppiche von Kamille, Margueriten und Hungerblumen, und ganz
besonders sticht ein orangefarbenes Narzissengewächs ins
Auge. Mastreita, d.h. Sternchen, ist der Name für eine
andere hier vorkommende Blume. Inmitten der Moose,
Ligaretta Magelanica, stoßen wir auf den ausgebleichten
Panzer eines Gürteltiers.
Nachts lockert es auf und es zeigt sich das Kreuz des
Südens. Nach dieser Wildübernachtung in der Eiseskälte der
patagonischen Steppe erleben wir den morgenden Tag im
strahlenden Sonnenschein. Auch der stürmische Wind hat
fühlbar nachgelassen, so daß wir unseren Weg Richtung El
Calafate fortsetzen können.
Nach kurzer Fahrt mit imposanten Tiefblicken zeigt sich der
dritte große See von Tres Lagos, der Lago Viedma, mit einer
spektakulären Szenerie im Hintergrund, die vom Mount Fitzroy
(3406 m) überragt wird, der – nach Robert FitzRoy, dem
Kapitän der Beagle, benannt – früher nach den Ureinwohnern
Chaltén hieß.
Der Mount Fitzroy ist einer der am schwierigsten zu
ersteigenden Berge der Welt. Selbst Bergsteigergrößen wie
Reinhold Meßner, der zwar viel über ihn geschrieben, ihn
aber nicht bezwungen hat, haben sich an ihm die Zähne
ausgebissen. Die besondere Schwierigkeit dieses Berges sind
die vereisten, fast senkrechten Felswände und das
unberechenbare, sich schnell ändernde Wetter, woran schon
zahlreiche Bergsteiger gescheitert sind. Die meisten
Touristen, die hierher kommen, begnügen sich mit seinem
Anblick und unternehmen bestenfalls eine Trekking-Tour zu
seinen Füßen. Seine Berühmtheit verdankt der Berg den beiden
Felsnadeln, die ihm sein charakteristisches Aussehen
verleihen, das seinesgleichen sucht. Man nannte letztere
sehr anschaulich „Fangzähne der patagonischen Anden“. Das
macht den Chaltén zugleich zu einer der majestätischsten
Berggestalten der Welt, was um so verwunderlicher ist, als
es in den Anden nur wenige Gipfel gibt, die sich dessen
rühmen können.
Im Grenzgebiet zwischen Argentinien und Chile befindet sich
das größte zusammenhängende Gletschergebiet der Erde
außerhalb der Polarbereiche. In dieser Gegend haben die
beiden deutschen Pionierflieger Gunther
Plüschow,
der hier am Lago Argentino abgestürzt ist, und Ernst Treblow,
sein Bordmechaniker, traurige Berühmtheit erlangt.
Plüschow
hatte sich mit seiner stoffbespannten Nur bereits als
Flieger von Tsingtau einen Namen gemacht. In den Folgejahren
kam er als Militärflieger nach Feuerland, wo ihm in einer
mit BMW-Motoren ausgestatteten D24 als erstem die
Überfliegung des Paine-Massivs gelang, ein Erlebnis, welches
er mit euphorischen Worten in seinem Buch „Silberkondor über
Feuerland“ schilderte. Nachdem er in Punta Arenas gestartet
war, mußte er infolge Treibstoffmangels und weil sich Eis am
Propeller gebildet hatte, in Ushuaia notlanden.
Vom Lago Viedma setzen wir unsere Fahrt im Flußbett des Río
Leona, der in diesen See mündet, in Richtung Lago Argentino
fort. Ein patagonischer Fuchs, vereinzelte Guanakos und
einige Wildpferde sind neben dem sich im Winde wiegenden
Ichu-Gras und den blau blühenden Disteln die einzigen Zeugen
für Leben in dieser Öde. Die Calafate-Beere oder Berberitze
ist eines der wenigen Gewächse, die dem Menschen natürliche
Nahrung boten. „Wer einmal von ihr gekostet hat, kehrt immer
wieder hierher zurück“, sagt ein altes Sprichwort.
Eines der wenigen Raubtiere Patagoniens, dessen Lebensraum
bedroht ist, ist der Puma, der verfolgt und bejagt wird,
weil er die Schafe auf den Estancias reißt. Es ist grotesk,
daß Lebensformen, denen dieser Lebensraum eigentlich gehört,
sterben müssen, damit andere, eingeführte und fremde
Tierarten sich ausbreiten können.
Auch die Geologie drückt durch bunte Bänderung im Gestein
der Landschaft ihren unverkennbaren Stempel auf. Aufgrund
des spärlichen Bewuchses ist auch die Bodenkrume äußerst
dünn.
Die türkis fließenden Wasser des Rio Santa Cruz, der sich in
zahlreichen Windungen, silbern glitzernd, dahinschlängelt,
ohne daß irgendeine Vegetation seine Ufer säumt, entwässern
den Lago Argentino in den Atlantik.
El Calafate ist Sprungbrett für individuelle Trekkingtouren
oder andere organisierte Ausflüge in die Gletscherwelt von
Los Glaciares, dem wohl bekanntesten Nationalpark
Argentiniens, der an landschaftlicher Schönheit den
Höhepunkt unserer bisherigen Reise darstellt. Der wohl
berühmteste Gletscher des Nationalparks aber ist der Perito
Moreno. Er ist nicht der längste, vielleicht aber der
spektakulärste Gletscher, der sich in den Lago Argentino
ergießt. Er wurde erst 1888
 von dem Glaziologen Louis Agassiz entdeckt, dem es auch zu danken ist, daß die
Glaziologie als eigenständige Disziplin von der Geologie
abgetrennt wurde. Nach ihm ist der 3180 m hohe Cerro Agassiz
benannt, einer der höchsten Berge des patagonischen
Inlandeises.
von dem Glaziologen Louis Agassiz entdeckt, dem es auch zu danken ist, daß die
Glaziologie als eigenständige Disziplin von der Geologie
abgetrennt wurde. Nach ihm ist der 3180 m hohe Cerro Agassiz
benannt, einer der höchsten Berge des patagonischen
Inlandeises.
Der Perito Moreno ist ein sogenannter warmer und damit
schnellfließender Gletscher, der sich bis zu 1,50 m täglich
in den See hinausschiebt. Es gibt kein Durchkommen zwischen
diesen wie Zacken eines Rechens dicht an dicht gepackten
Kegeln von Eiszapfen, den furchteinflößenden
Gletscherspalten, unter denen sich unterirdische Eishöhlen
auftun, wo nur Barsche und Forellen sich heimisch fühlen.
In besonders strengen Wintern, wenn der Gletscher bis zur
gegenüberliegenden Landzunge vorrückt wie zuletzt 1988, kann
es vorkommen, daß ein Seitenarm, der Brazo Rico, vollkommen
abgeschnürt wird, so daß es zu einer Zweiteilung und
Aufstauung des Sees kommt, wobei der Wasserspiegel im oberen
um bis zu 20 m höher liegen kann als im unteren Teil des
Sees. Dann passiert, was sich seit Menschengedenken immer
wieder auf dieselbe Weise ereignet: Sobald die nächste
Sommersonne ihre ersten wärmenden Strahlen auf die
gewaltigen Eismassen herabschickt, setzt der Schmelzprozeß
ein, die Eisbarriere fällt und die aufgestauten Wassermassen
ergießen sich einem Sturzbach gleich in den unteren See.
Zeugen dieses spektakulären Naturereignisses sind die
zahlreichen abgestorbenen Baumstümpfe, die nicht wegen eines
Zuwenigs, sondern wegen eines Zuviels an Wasser in den
Fluten ertranken. Es sind die gleichen Urgewalten, die sich
alljährlich auch an den Polen vollziehen, wenn Eisflächen,
die dreimal so groß sein können wie die Insel Mallorca, sich
aus dem Schelfeis lösen. Mit zunehmender Erderwärmung werden
sich immer größere Eisschollen abspalten, die sich dann bis
in den Südatlantik oder Südpazifik vorschieben.
Am Brazo Rico stürzte am 28. Januar 1931 der Marineflieger
Gunther Plüschow zusammen mit seinem Bordmechaniker Ernst
Treblow ab. Treblow, der den Sturz aus 50 m Höhe überlebt
hatte, wurde zwar von Schafhirten gerettet, starb aber
schließlich infolge des Kälteschocks beim Eintauchen ins
eiskalte Wasser. Als Ausdruck der deutsch-argentinischen
Freundschaft hat man den beiden hier ein Denkmal errichtet.
Da die meisten Gletscher, die vom patagonischen Eisschild in
den Lago Argentino münden, im hinteren, weitgehend
unzugänglichen Teil des Sees gelegen sind, muß man sich an
diese Stellen auf dem Wasser herantasten. Es ist schon ein
großartiges Erlebnis, wenn man sich dem Gletscher mit dem
Boot nähert und das Kalben vom Wasser aus beobachten kann.
Gespannt starren wir auf die 60 m hoch aufragenden Eiswände,
an die sich unser Katamaran nicht zu dicht heranwagen darf,
denn wenn ein größeres Stück abbricht, könnten die
ausgelösten Flutwellen ins Boot schwappen und dieses
womöglich zum Kentern bringen. Die Stellen nämlich, an denen
die Eislawinen sich hangrutschartig ablösen und alles unter
sich begraben, sind Ausgangspunkt von Kugelwellensystemen,
die sich weit in den See hinaus ausbreiten und die Boote,
die draußen in Lauerstellung liegen, ins Schaukeln versetzen
können.
Sicherer ist es, das Kalben des Gletschers vom Land aus zu
beobachten. Ein angelegter Rundweg führt am anderen Ufer
entlang und gestattet den Anblick aus unterschiedlichsten
Perspektiven. Mit ein wenig Geduld kommt man in den Genuß,
das Kalben aus nächster Nähe verfolgen zu können. Es kündigt
sich an, indem sich zunächst kleinere Brocken ablösen, ehe
dann immer größere und gewaltigere Blöcke abbersten, bis die
Eismassen schließlich unter entsetzlichem Getöse an der
Vorderkante des Gletschers gänzlich abgehen. Die geborstenen
Eiswände tauchen dann, als würden sie nach Luft ringen, nach
kurzem Eintauchen wieder auf und treiben als Eisberge davon,
teils weit auf den See hinaus, bis sie irgendwann
vollständig abgeschmolzen sind. Dies ist der ewige Kreislauf
zwischen Wasser und Eis, der sich im Wechselspiel mit der
Natur seit Urzeiten in stets gleichbleibendem Rhythmus
vollzieht, eine Abfolge von Tod und Wiedergeburt der
Elemente.
Die zahlreichen Ausflugsboote, zumeist Katamarane, fegen mit
enormen Geschwindigkeiten über die Wasserfläche. Am
unruhigsten ist auf solchen Schnellbooten der Aufenthalt
nahe am Bug, und das ständige Stampfen des Schiffs kann bei
manchem Übelkeit auslösen. Während über uns die Wolkenfetzen
über den Himmel jagen und der Wind das Wasser peitscht,
ziehen schneebedeckte Berge an uns vorüber, und zerklüftete
Felswände in der Nähe rauben uns vorübergehend die Sicht, so
als wollten sie uns erdrücken. Auch gekalbte Eisberge sehen
wir bläulich in der gleißend hellen Gischt vorbeitreiben,
und immer wieder mischt sich das dröhnende Geräusch der
Motoren darunter, wenn das stampfende Schiff sich an den
meterhohen Wellen bricht. Der Lago Argentino ist der größte
See Argentiniens, an seiner breitesten Stelle 20 km breit,
an der schmalsten nur 800 m, und er bedeckt die riesige
Fläche von 135.000 km2. Alle Gletscher, die in
den See münden, sind nach bekannten Forschern benannt, etwa
der Spegazzini oder der Agassiz, die zu den spektakulärsten
Gletschern überhaupt zählen, von denen man je gehört oder
gesehen hat.
Nach mehrstündiger Fahrt sehen wir in der Ferne die ersten
flachen Gletscherzungen auftauchen, die uns die gigantischen
Eismassen des Upsala-Gletschers ankündigen. An der Stelle,
wo dieser in den See mündet, ist zugleich dessen tiefste
Stelle, die hier ganze 700 m hinabreicht. Außer zu beiden
Seiten schwimmt alles Eis auf dem See, was ihm letztendlich
auch zu seinem Ruhm verholfen hat. Die Fahrt zum
Upsala-Gletscher, dem größten in Süßwasser kalbenden
Gletscher der Erde, ist ein recht abenteuerliches
Unterfangen, nicht nur wegen der gewaltigen Ausmaße dieses
Eisfeldes, sondern auch, weil die Böen an jener Stelle des
Sees besonders rauh sind, die Wellen aufgrund der
peitschenden Fallwinde sich hier höher auftürmen als weiter
draußen. An Deck der Schiffe kann es daher recht unangenehm
werden, vor allem aufgrund des Spritzwassers, das ungeeignet
gegen den Regen Geschützte auf einen Schlag bis auf die Haut
durchnässen kann.
Es muß auch noch auf eine andere Gefahr hingewiesen werden,
die von Touristen aus Mitteleuropa leicht übersehen wird,
die Intensität der Sonne. Seitdem bekannt ist, daß sich das
Ozonloch auch bis weit in den Süden Chiles und Argentiniens
ausgedehnt hat, kann nicht oft genug betont werden, daß man
sich zum Schutz gegen die Sonneneinstrahlung unbedingt
eincremen muß, am besten mit dem höchsten Lichtschutzfaktor,
den es gibt. Sonst kann es sein, daß die Halskrause bald
unangenehm brennt.
Im Brazo Spegazzini reichen die Berge mit ihrem Steilabfall
bis fast an den See heran, und es ist ein überaus
eindrucksvolles Bild, welches für immer im Gedächtnis haften
bleibt, die blendend-weißen Eismassen zu erleben, mit der
grünen Flora im Hintergrund. Wären da nicht die
Ausflugsboote, die stets in respektvollem Abstand zu den
Eisbrüchen bleiben, und wäre man hier mit der Natur und sich
allein, und nicht der hektischen Fotografiersucht der
Passagiere ausgesetzt, könnte man zu völliger
Selbstvergessenheit hinschwinden.
In der Onelli-Bucht gehen wir an Land, um auf einem
Spaziergang der Natur noch ein Stück näherzurücken. An dem
Punkt wurde eine Schiffsanlegestelle eingerichtet, weil man
zu den beiden kalbenden Gletschern nicht anders gelangen
kann als durch einen kurzen Fußmarsch. Dieser führt durch
lichten Urwald zum Fuß des Agassiz- und Bolado-Gletschers,
deren Kälber auf dem kurzen Gletscherfluß in den See
hinaustreiben. Die auf dem Fluß schwimmenden Eisklumpen
liefern einen reizvollen Kontrast zu der unberührten Natur
ringsum. Das Abweichen vom Weg und das Betreten des
Naturschutzgebiets auf eigene Faust sind untersagt.
Eine Bootsfahrt auf dem Lago Argentino in den Parque
Nacional Los Glaciares zählt sicherlich zu den größten
Erlebnissen, die im südlichen Argentinien auf den Touristen
warten. Die Reise im Glasboot durch die aufgewühlten Fluten
des milchig-grünen Sees mit seinen weißen Schaumkronen,
inmitten bläulich schimmernder Eisberge, das weiche
Abendlicht mit seinen langgezogenen Schatten, die alle
Umrisse der violetten, hohen Felswände ringsum bizarr
hervortreten lassen, sind ein Naturerlebnis ersten Ranges,
das man um keinen Preis missen möchte. Als sich hinter uns
im augenschmerzenden Gegenlicht eine schwarze Wolke vor die
Sonne schiebt, kehrt Zufriedenheit in allen Herzen ein, denn
wer das Wetter hier kennt, weiß jede Stunde Sonnenschein zu
schätzen.
Auf der Rückfahrt vom Perito Moreno herrschen nahezu ideale
Lichtverhältnisse, wodurch die Farben dieser Landschaft erst
vollends zur Geltung kommen. Wenngleich Patagonien sehr viel
niedriger liegt als der Altiplano, erinnert dennoch vieles
an das Hochland von Bolivien. Insbesondere gleicht der Lago
Argentino hinsichtlich seiner Farbgebung und was die
Blautöne seines Wassers angeht, dem Titicacasee aufs Haar.
Durch die Gletscherzuflüsse hat das Wasser im Normalfall die
charakteristisch grüne Farbe unserer heimischen
Gebirgsflüsse, die je nach Lichteinfall zwischen einem
tiefen Blau und einer türkis-hellen Einfärbung schwanken
kann. Seichtere Stellen wirken manchmal etwas unschön braun.
Die Anden dagegen leuchten bei klarer Sicht aus der Ferne
violett bis lilafarben, aus der Nähe hingegen sehen sie
ockerfarben bis hellbraun aus. Die Gräser schließlich
verlieren das ganze Jahr über nie ihre charakteristisch
gelbe Farbe, während die übrige Vegetation durch hellgrünes
Laub, dunkelgrüne Sträucher und rostrote Gräser ein
harmonisches Ganzes bildet, so daß die Landschaft aussieht
wie ein bunter Blumenteppich, und wo Fels zutage tritt,
mischen sich in diese Palette noch Grau- oder Rottöne. Mit
dem leuchtenden Blau des Himmels, dem Weiß der Wolken und
dem Schwarz der Schatten liegt das ganze breite Spektrum
südlicher Farben vor uns.
Vom Nationalpark Los Glaciares führt keine direkte
Verbindung in den Torres-del-Paine-Nationalpark. Man ist
daher gezwungen, den Umweg über La Esperanza zu machen und
bei Cerro Castillo die Grenze zu Chile zu überschreiten. Als
die Straße hoch über dem Lago Argentino eine Paßhöhe
erreicht, sehen wir bei einem letzten Blick zurück noch
einmal den Mount Fitz Roy, den höchsten Gipfel, majestätisch
in den Andenhimmel ragen. Gut erkennbar zieht sich der Río
Santa Cruz in zahlreichen Windungen durch ein breit
ausgewaschenes Tal. Danach entziehen sich die Berge von Tres
Lagos für immer unseren Augen, und wir befinden uns wieder
in den eintönigen und monotonen Weiten der patagonischen
Steppe, die langweiliger nicht sein könnte.
Schnurgerade zieht sich die Straße zwischen den Weidezäunen
umzäunter Estancias hin. Kaum ein Lüftchen regt sich, und es
ist angenehm warm. Da tauchen plötzlich in der Ferne die
Torres del Paine auf, deren Name allein schon ein Prickeln
hervorruft. Sie sind bereits aus großer Entfernung
erkennbar, und wir nähern uns ihnen von argentinischer Seite
 aus. Ihr Massiv ragt mitten aus der patagonischen
Steppenlandschaft heraus. Ein weiteres Massiv nennt sich der
Schlafende Indio.
aus. Ihr Massiv ragt mitten aus der patagonischen
Steppenlandschaft heraus. Ein weiteres Massiv nennt sich der
Schlafende Indio.
Die Straße in den Nationalpark wird gerade geteert, somit
werden wohl bald noch mehr Touristen kommen, um auch die
letzten Oasen der Natur mit ihren unreinen Händen zu
berühren.
In wohl jedem, der Chile bereist, werden die größten
Erwartungen geweckt, wenn vom Paine-Nationalpark die Rede
ist, und freudige Erregung kommt auf, wenn man sich den
Torres zum ersten Mal nähert.
„Sei versichert, daß es ganz anders sein wird, als du es dir
in deinen kühnsten Träumen ausgemalt hast“, meint meine
Begleiterin. „Schätze dich glücklich, daß du zu den wenigen
zählst, denen es vergönnt ist, daß sie die Torres und
Cuernos überhaupt zu sehen bekommen, denn es ist durchaus
keine Seltenheit, daß es eine Woche lang ununterbrochen
regnet, und es ist auch schon vorgekommen, daß selbst
ambitionierte Bergsteiger nach einer Woche Ausharrens
unverrichteterdinge wieder abziehen mußten.“
Das Paine-Massiv ist eine der spektakulärsten Berggruppen
der Welt, und sein Grundstock wurde vor rund 135 Millionen
Jahren, im Erdzeitalter des Pleistozäns, durch eine
unterirdische Magmakammer gelegt. Durch die eiszeitliche
Erosion der Gletscher während der Kaltzeiten wurde der unter
dem Sedimentgestein befindliche harte Granit freigelegt, und
daher sieht man auf den Hörnern Kappen aus dunklerem
Sedimentgestein aufsitzen.
Das Paine-Massiv liegt am östlichen Abhang der Kordillere in
der Region Magallanes. Die Cuernos, die Hörner, tragen im
Unterschied zu den Torres ein schwarzes Dach. Das Haupthorn,
das Cuerno principal, ist 2600 m hoch, das nördliche Horn
2260 m. Die mit 3050 m
höchste Erhebung des Paine-Massivs jedoch ist der Paine
Grande. Die drei granitenen Felszinnen, der Torre Agostini,
der Torre Central und der Torre Norte, stellen für
Bergsteiger die weltweit größte Herausforderung dar,
hauptsächlich wegen des Steinschlags und der latenten,
ständig wechselnden Wetterbedingungen. Als erster wurde 1963
der Torre Central bestiegen.
Was den Paine-Nationalpark vor allem auszeichnet, sind die
zahlreichen, in allen Blautönen schimmernden Seen, allen
voran der Sarmiento-See, die Laguna Azul, die Laguna Amarga,
der Pehoé-See und der Lago Grey, in den der Grey-Gletscher
kalbt. Seine Fauna, deren bestimmende Art die Herden von
Guanakos sind, lebt von den schwarzen Tijara-Enten mit ihren
schwarzen Schnäbeln sowie den nur hier vorkommenden
Schwarzhalsschwänen und Weißhalsibissen.
In jener subantarktischen Gegend stoßen wir vermehrt auch
auf Südbuchenarten, die klein und verkrüppelt sind. Die
ersten Siedler, die ins Land kamen, gaben den Bäumen, die
sie hier vorfanden, Namen aus der Heimat, gerade wie sie sie
eben von zu Hause kannten, so auch der Südbuche (Notophages).
Diese wirft, um Wasser zu sparen, im Herbst ihre Blätter ab,
nachdem sich zuvor das Laub blutrot gefärbt hat. Riesige
Südbuchenwälder bilden das Einzugsgebiet des
Paine-Nationalparks, doch sind die meisten der Bäume
abgestorben.
Der Wind bläst um so stärker, je weiter wir nach Süden
vordringen, und der Staub schneidet einem die Luft ab. An
der Grenze erfahren wir, daß gestern in der Gegend
Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h gemessen wurden.
Außer dem Gürteltier kommt hier noch das Steißschopfhuhn
vor, allerdings auch dieses äußerst selten. Am Ende der
letzten Eiszeit jedoch lebten im nördlichen Amerika noch
Säbelzahntiger und eine besondere Art von Riesenfaultier,
das sogenannte Milodon, dessen Knochenreste sowie ein Stück
Haut ein gewisser Kapitän Eberhard in einer Höhle bei Puerto
Natales gefunden hat. Als sich vor 10.000 Jahren die
Gletscher zurückzogen, entstand an der Stelle, wo sich heute
die Höhle befindet, in dem weichen Sedimentgestein durch
Auswaschungen eines Gletschersees die Milodon-Höhle, wo man
weitere Versteinerungen, darunter auch menschliche
Überreste, gefunden hat. Der See wich, die Höhle ist
geblieben. Wir haben hier das anschauliche Bild vor Augen,
wie ausgehungerte Säbelzahntiger dem Riesenfaultier
auflauern, das selbst ein reiner Pflanzenfresser war und
sich von den Blättern der Bäume ernährte, zu welchem Zweck
es sich in voller Höhe aufrichten mußte. Eine Nachbildung
dieses Kolosses sieht man heute im Museum von Punta Arenas.
Die Höhle selbst gleicht mehr einer Grotte, was sie
genaugenommen auch ist, aber sie enthält weder Stalaktiten
noch Stalagmiten, da es sich augenscheinlich nicht um
Kalkgestein handelt, das hier zu Sedimenten verkittet ist.
Mit ein wenig Fantasie mag man sich den permanenten
Lebenskampf in dieser rauhen Umgebung anschaulich
vorzustellen, man sieht den Schnee sich rot färben vom Blut
dieser mittlerweile ausgestorbenen großen Säugetierart, die
in den Fängen des Säbelzahntigers ihren letzten Atemzug
aushauchte. Jede einzelne Kralle des Tiers war so groß wie
eine Kinderhand.
Ganz in der Nähe der Milodon-Höhle, beim sogenannten
Teufelsstuhl, der Silla del Diablo, einem weithin sichtbaren
Felsen aus Sedimentgestein, der tatsächlich in seinem oberen
Teil aussieht wie ein Stuhl mit ebener Sitzfläche, wählen
wir auch unsere heutige Wildübernachtung. Der oben plane
Felsblock böte einen idealen Ring für den Schwertkampf
zweier Helden, denn der Gipfelaufbau fällt allseits steil
ab, so daß es einer klettertechnischen Ausrüstung bedürfte,
ihn zu besteigen. Die Ursprünglichkeit dieser Formation
tritt um so mehr zutage, als Sedimentgestein in der Regel
wenig einladend aussieht. Doch hier, wie schon beim
Paine-Massiv, liegen die Verhältnisse anders.
Auch die benachbarten Anhöhen sind urwüchsig, aber
unschwierig zu besteigen. In den Mulden haben sich dichte,
moosbewachsene Südbuchenwälder erhalten, die kein
Durchkommen ermöglichen. Vom höchsten zu erreichenden Punkt
genießt man einen fabelhaften Rundblick hinab auf den Fjord
Ultima Esperanza, auf steile Bergzüge ringsum und
ausgedehnte Ebenen, und als die Sonne ihre letzten
blendenden Strahlen durch das nebelartige Gewölk schickt,
hinter dem sich verschneite Berge verhüllen, leuchtet der
ganze Meeresarm wie ein reflektierender silberner Spiegel.
Die seltsam verkrüppelten, aufgrund ihrer feingliedrigen
Blätter fast durchsichtig wirkenden Bäume, die sich unter
dem aus der ständig gleichen Richtung wehenden Wind alle auf
die gleiche Seite neigen, bieten in der untergehenden Sonne
ein gespenstisches Bild. Hier mögen einst die
Tehuelche-Indianer ihren Göttern geopfert haben,
entpersonifizierte, sich in den Naturgewalten
manifestierende überirdische Mächte, über die wir kaum etwas
in Erfahrung bringen können.
In der Nacht zeigt sich der südliche Sternenhimmel in seiner
ganzen Pracht: Orion, das Kreuz des Südens und Eridanus sind
auf den ersten Blick zu erkennen. In tiefen Schlaf versunken
weckt mich folgender Traum: Auf schnurgerader Straße
beobachten wir eine Staubwolke, die höher und höher steigt,
dann aber über sich einen Atompilz ausbildet, und wir fühlen
deutlich, wie die Hitze immer weiter ansteigt. Als ich fast
zu verbrennen drohe, wache ich auf, und schlagartig wird mir
klar, daß alles nur ein böser Spuk war.
Der nächste Tag startet mit einem prächtigen Morgenrot, und
die umgekippten Steinklötze fangen schon bald das erste
Sonnenlicht ein, als unser Werk früh beginnt. Nachdem wir
unser Lager am Ultima-Esperanza-Fjord abgebrochen haben,
gilt es als nächstes, die Magellanstraße zu überqueren.
Hier, im Grenzgebiet zwischen Argentinien und Chile, sind
noch immer zahlreiche Landminen verlegt, und immer wieder
kommt es dadurch zu Personenunfällen. Vermutlich deswegen
verfolgt mich in der Nacht folgender Traum: Es gab einen
Kampf, an dessen Ende sich mein Gegner, in einem Schacht
frei in der Luft hängend, an meinem Bein festgeklammert
hält. Jederzeit hätte ich ihn mit einem Fußtritt in den
Schlund befördern können, und es wäre völlig unnötig
gewesen, ihm mein Messer in den Hals zu stoßen. Aber ich tue
es, und die Frauen, die das sahen, sagten: „Er war der
schönste Mann.“
In Puerto Natales geben unzählige Kormorane sich ein
Stelldichein. Hier, im südlichen Chile, ebenso wie im
Nachbarland Argentinien, gilt der ganze Stolz der
Einheimischen noch
immer ihren Gauchos, die früher die Gegend unsicher
machten und den Landbesitzern zum Problem wurden. Sie
verdingten sich später, nachdem man ihnen ihre unbeschränkte
Freiheit genommen hatte, teils als Rinder- und Schafhirten
auf den Estancias der Großgrundbesitzer, teils in der Armee,
wo sie aufgrund ihrer Tapferkeit geschätzt und gefürchtet
waren. Immer wieder treffen wir auf die Nachfahren dieser
wilden Gesellen, deren ganzer Stolz die edlen Zuchtpferde
sind. Viel mehr als Nostalgie und Sentimentalität ist von
dieser Gaucho-Romantik allerdings nicht geblieben.
Seltsam genug mitanzusehen, wenn Kühe hinter Hunden herjagen
oder, wenn sich das Spiel umkehrt, jene im Davonlaufen nach
diesen ausschlagen. Dennoch bleiben die Hunde in diesem
Wechselspiel letztlich immer die Sieger, so sehr haben sie
ihr typisches Verhalten eingeübt.
In Punta Arenas steht auf der Plaza das Magellandenkmal: ein
bescheiden gekleideter, barhäuptiger Mann, mit einem Hut in
der Hand, blickt zum Himmel empor, so als würde ihm eine
Vision vorschweben. Die Stadt besitzt ein interessantes
Museum, das von den Salesianern eingerichtet wurde und in
welchem eine umfangreiche Sammlung der verschiedenen hier
vorkommenden Arten aus Fauna und Flora ausgestellt ist sowie
ein Abriß der Erschließungsgeschichte und der früher hier
lebenden Ethnien gegeben wird. In Punta Arenas legen auch
die großen Kreuzfahrtschiffe an, und von hier aus können
Landausflüge zu den Pinguinkolonien bei La Pinguinera
unternommen werden.
Erwachsene werden wieder zu Kindern, wenn es irgendwo
Pinguine zu beobachten gibt. Doch nicht nur diese sind es,
die bei den Leuten Entzücken hervorrufen. Es wimmelt nämlich
in dieser Gegend auch von Nandus, so daß es überhaupt nichts
Besonderes ist, diese Straußenart hier anzutreffen. Die
südamerikanischen Nandus sind mit den afrikanischen Straußen
allerdings nicht verwandt. Der Hahn baut das Nest und brütet
auch allein. Auch Füchse zeigen sich ungeniert auf dem
Gelände der Pinguine, ohne daß diese von ihnen Notiz nehmen
würden.
Punta Arenas besitzt als Besonderheit noch einen
eindrucksvollen Friedhof, wo ganze Familienclans in
richtiggehenden Tempelgräbern bestattet wurden. Bekannteste
Persönlichkeit ist die Großgrundbesitzerin Sara Braun, die
in ihrem Testament angab, daß ein Tor des Friedhofs, nachdem
es sich hinter ihr geschlossen habe, nie wieder geöffnet
werden dürfe, und man erfüllte ihr diesen Wunsch.
Obwohl es auch von Punta Arenas aus möglich wäre, die
Magellanstraße zu überqueren, bevorzugen wir für die
Überfahrt mit der Fähre die schmalste Stelle bei Punta
Delgada. Dort nämlich, wo Cabo Deseado liegt, das „ersehnte
Kap“, ist die Magellanstraße am engsten. Das Land zu beiden
Ufern liegt flach und gelb wie ein Wüstenstrich. Nur einen
Steinwurf entfernt liegt auf der gegenüberliegenden Seite
Tierra del Fuego, Feuerland, das seinen Namen Kaiser Karl V.
verdankt, der aufgrund dessen, was ihm die Überlebenden der
ersten Weltumseglung erzählten, spontan entschied, dieses
Land so zu benennen. Von der Wortironie ahnte der Wortgeber
freilich noch nichts, denn heute werden dort Erdöl und
Erdgas gefördert, und das Feuer züngelt aus den
Abfackelungsanlagen. Die Eingeborenen hatten damals viele
Feuer entzündet, zum Schutz gegen die schneidende Kälte, die
dem Besucher dieses Strichs auf dem Erdkreis normalerweise
entgegenschlägt. Heute jedoch herrschen Temperaturen von
über 20 °C, 1000 km von der Antarktis entfernt: erste
Anzeichen einer globalen Erwärmung. Es ist auch seit zwei
Tagen völlig windstill, was die Wärme noch spürbarer macht.
Die Wolkendecke reißt zeitweilig auf, und das Meer wie der
Himmel zeigen sich in einem arktischen Blau.
Die Fähre Valparaiso bringt uns in wenigen Minuten ans
andere Ufer, ebenfalls noch chilenisches Gebiet. Irgendwo
draußen auf der Straße kreuzen wir genau die Stelle, über
welche Magellans Karavelle hinwegsegelte, ein erhebender
Augenblick, der Gänsehaut hervorruft. Und wenn einer nur
lange genug wartet, sieht er vor seinem geistigen Auge alle
vier Karavellen vorbeisegeln, an Bord Männer mit blitzenden
Helmen und Harnischen, gespannt Ausschau haltend, und er
hört die Böllerschüsse, vor denen selbst das Meer
zurückweicht, als sie die Engstelle passieren, hinaus in ein
noch gewaltigeres Meer, als sie es je gesehen hatten, den
Großen, den Stillen Ozean. Keiner dieser bärtigen Männer
weiß in dem Augenblick noch, ob er die Heimat je wiedersehen
wird, keiner kann die lauernden Gefahren und die zahlreichen
Fährnisse, welche dort auf sie warten, und die
unbeschreibliche Ausdehnung des Ozeans richtig bemessen. Als
die vier Segel in der aufgehenden Sonne, in den Weiten des
Ozeans verschwinden, ist noch keinem von ihnen klar, von
welcher Tragweite dieses Ereignis einst sein würde. Später,
viel später, kam ein anderer, der kein geringerer war als
der Pirat Sir Francis Drake, mit der Golden Hinde, die
vollbeladen war mit Schätzen, und umschiffte Kap Hoorn. Bis
dahin aber würde die Fahrt del Canos bereits Berühmtheit
erlangt und andere zu den gleichen Herausforderungen
ermutigt haben, und selbst der Papst in Rom zuckte auf
seinem Stuhl zusammen, als er erfuhr: das alte Weltbild des
Ptolemäos, es galt nicht mehr.
Niemand würde doch das Verdienst Magellans schmälern oder
ihm seine große Leistung absprechen wollen, bleibt er doch
unangefochten der erste, dem eine Weltumseglung glückte,
wenngleich er selbst dabei den Tod fand und del Cano und
seine Gefährten den ihm gebührenden Ruhm einheimsten. Sieht
man sich auf der Landkarte den argentinischen Küstenverlauf
genauer an, so muß man sich mit Ausnahme einiger weniger
Buchten, die sich zumeist mit Flußmündungen decken,
eingestehen, daß dieser nahezu geradlinig verläuft und wenig
Möglichkeiten bietet, sich nach einer Passage hinüber zum
Pazifik umzusehen. So liegen denn südlich des Río Deseado
noch der Río Chico bzw. der Río Santa Cruz und der Río
Gallegos, wo nach einer solchen Durchfahrt hätte gesucht
werden können. Mithin mußte denn Magellan bei Cabo Virgenes
fast unweigerlich in die nach ihm benannte Schiffahrtsstraße
hineinsegeln, um schließlich am Salzgehalt des Meeres
festzustellen, daß es sich dieses Mal um keine Flußmündung
handelte, sondern um eine Meerenge, deren genauer Verlauf
von ihm auszuloten war. Finden sich doch weiter im
Landesinnern Fjorde, Irrwege durch ein Insellabyrinth, in
dem man sich leicht hätte verlieren können. Doch in
Anbetracht der strengen Auflagen, die Magellan gemacht
worden waren, nämlich auf dem Seeweg nach Westen die
Gewürzinseln d.h. die Molukken zu erreichen, um das
portugiesische Handelsmonopol zu brechen, war ihm von
Anbeginn an ein westlicher Kurs aufgezwungen, von dem er, um
die Reisedauer nicht über Gebühr in die Länge zu ziehen,
auch kaum hätte abweichen können. So lag etwa die Durchfahrt
in die nächste Bucht bei Punta Delgada exakt in westlicher
Himmelsrichtung, und auch der Weg an Punta San Vicente
vorbei war nahezu vorgegeben. An der Insel Isabel wiederum
war die Südrichtung zwingend vorgeschrieben, und daß
Magellan die Meerenge zwischen der Brunswick-Halbinsel und
der Dawson-Insel wählte und nicht in die Bahía Inútil bzw.
den Whiteside-Kanal einlief, kann man ihm gar nicht
verdenken, weil er doch westwärts segeln mußte. Hinter Cabo
San Isidro, etwa in Höhe des Monte Victoria, hatte Magellan
erneut keine andere Wahl, als die Brunswick-Halbinsel zu
umschiffen. Hätte er nun den Weg Richtung Norden gewählt, so
wäre er in den Otway-Sund geraten und hätte dann
zurücksegeln müssen, also nahm ihm auch hier wieder das
Gesetz der Logik die Entscheidung ab und ließ ihn an der
Córdoba-Halbinsel nordwestlichen Kurs nehmen, bis er
schließlich, vorbei an der Insel Desolación, bei Puerto
Miseriocordia den offenen Pazifik erreichte: die Durchfahrt
war gefunden. Über alldem darf nicht vergessen werden, daß
es allein Magellans Betreiben und seiner Energie und
Ausdauer zu verdanken ist, daß diese Reise stattgefunden
hat, denn nachdem der portugiesische Königshof sein Ansinnen
zurückgewiesen hatte, nahm ihn der spanische bereitwillig
auf. Auch wenn Magellans Reise ihr Ziel, nämlich die
Gewürzinseln in den Besitz Spaniens zu bringen, fehlschlug,
so hat sie dennoch den letztendlichen Beweis von der
Kugelgestalt der Erde erbracht.
Auf Ferdinand Magellan folgte sechs Jahre später die von
Kaiser Karl V. ausgestattete zweite Expedition des García
Jofre de Loaísa, die durchweg unglücklich verlief. Seine
sieben Schiffe segelten mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit. Mitte Mai
gelangte Loaísa nach Durchquerung der Magellanstraße mit
vier verbliebenen Schiffen in den Pazifik. Das Flaggschiff
Santa Maria de la Victoria war das einzige, welches
das Expeditionsziel erreichte.
1535 wurde Simón de Alcazaba, Kommandeur zweier Schiffe, in
der Magellanstraße von Meuterern umgebracht. Nur eines der
Schiffe erreichte die Heimat wieder.
1537 befuhren der Italiener León Pancaldo – auf der Santa
Maria – und sein zweiter Kapitän Juan Pedro de Vivaldo –
auf der Concepción –, von Cádiz kommend, die
Magellanstraße. Pancaldo starb im Jahr darauf am Río de la
Plata, von Wilden aufgefressen.
1539 brachen drei Schiffe unter dem Kommando von Francisco
de la Ribera – eines unterstand Francisco de Camargo und ein
anderes Alonso de Camargo –, in Richtung Magellanstraße auf.
Das eine ging verloren, ein anderes kehrte nach Spanien
zurück, das dritte, möglicherweise unter Alonso de Camargo,
durchfuhr die Meeresstraße und gelangte nach Valparaiso.
1553 unternahmen Francisco de Ulloa und Francisco Cortés de
Ojeda eine erneute Expedition. Hernán Lamero Gallego de
Andrade durchquerte die Straße von La Concepción in Chile
kommend im Oktober 1553 mit drei Schiffen. Dies war die
erste Durchquerung in West-Ost-Richtung.
Im Jahre 1557 erhielt Juán
Fernandez Ladrillero den Auftrag,
die Gegend südlich von Valdivia zu erforschen. Insbesondere
die Magellanstraße und deren westlicher Eingang sollten
erkundet werden. Auch diesmal wollte man sie in
entgegengesetzter Richtung durchfahren. Ladrillero
befehligte das Schiff San Luis und Francisco Cortés
de Ojeda die San Sebastian. Ein Sturm trennte sie,
das Flaggschiff ging verloren. Trotz mehrerer Anläufe konnte
Ladrillero die Durchfahrt nicht finden. 1558 erreichte er
Cabo Virgenes. Die Expedition kehrte 1559 nach Valdivia
zurück. Diese Reise leitete die Inbesitznahme Feuerlands
ein, die später mit der Errichtung kleiner militärischer
Basen durch Pedro Sarmiento de Gamboa bis 1579 fortgeführt
wurde.
1578 entdeckte Francis Drake, ein englischer Freibeuter, die
nach ihm benannte Schiffahrtsstraße, woraufhin es nicht mehr
nötig war, durch die Magellanstraße zu segeln, was vielen
Seeleuten trotz des langen Umweges lieber war.
In den darauffolgenden Jahren kamen noch zahlreiche andere,
die alle aufzuzählen hier zu weit führen würde.
Die Magellanstraße ist heute bevorzugtes Übungsgebiet der
chilenischen Tiefflieger. Mehrere Maschinen jagen gerade
über unsere Köpfe hinweg. Wir treffen bei jener Gelegenheit
auch zwei Testfahrer, die uns berichten, daß sie die Strecke
zwischen Buenos Aires und Ushuaia in nur 26 Stunden
bewältigt hätten.
Wer sich etwa Feuerland anders erträumt hat, als wir es
erleben, wird sich herb enttäuscht sehen. Der weitaus größte
Teil der Insel ist flach und baumlos. Anfangs begleitet uns
noch ein kurzes Stück Asphaltstraße, danach kommt nur noch
Piste, der schlechteste Teil auf unserer gesamten Strecke.
Auch werden die letzten Wälder Feuerlands gerade abgeholzt.
Feuerland ist entstanden, als die Gletscher während der
Eiszeit die Magellanstraße einschliffen.
Bisher hatte die ganze Welt geglaubt, daß die ersten
Menschen über die Beringstraße nach Amerika eingewandert
seien, doch wird diese These mittlerweile bestritten, da es
gesicherte Erkenntnisse gibt, daß es schon vor ihrer Ankunft
eine Besiedelung gab. Die Yahgan oder Alakaluf – sie
besitzen einen Wortschatz mit 32.000 Wörtern – lebten am
weitesten südlich, ihr Gebiet lag rund um den Beagle-Kanal.
Zum Aussterben der Ureinwohner trug maßgeblich die brutale
Landnahme durch die Weißen bei; die von ihnen
eingeschleppten Krankheiten und Kopfgelder für jeden
getöteten Indianer taten ein ihriges.
In seinem mittleren Abschnitt geht Feuerland in Waldgebiete
über, im nördlichen Teil bestimmen die Ausläufer der Anden
sowie Moore und Sümpfe das Landschaftsbild. Ebenfalls in
seinem nördlichen Teil ist Feuerland ein flaches,
unwirtliches und abstoßendes Land, im Aussehen ganz ähnlich
dem Patagoniens. Der Regenbogen und die Sonne sind hier
miteinander verheiratet, und die Erde bringt das rote
Fuchsschwanzgras hervor. Bei flach einfallendem Licht können
diese Grasflächen dem Aussehen von Getreidefeldern ähneln.
Die Sonne versinkt währenddessen ohne vernebelnde
Dunstschicht, so messerscharf berandet, wie ich es selten
gesehen habe. Nachdem zwischenzeitlich zwei Fronten
durchgezogen sind, klart es in der Nacht auf. In den Weiten
Feuerlands funkeln die Sterne in der mondlosen Nacht in
ihrer ganzen Pracht. In der kalten sauberen Luft sieht man
das Sternbild des Eridanus, des Unterweltflusses, über dem
Horizont stehen. Am nächsten Morgen hat sich Frost gebildet,
so daß wir unser Frühstück im Stehen einnehmen müssen.
Es grenzt schon an Aberwitz, sich Feuerland auf dem Landweg
erschließen zu wollen, wo doch eine Seereise ungleich
abenteuerlichere Eindrücke vermitteln würde.
Alsbald gelangen wir in die ausgedehnten Niedrigwaldgebiete
Mittelfeuerlands, wo sich am Lago Fagnano ein erster
Ausblick auf die schneebedeckte Kette der Darwin-Kordillere
auftut. Die Landschaft mit ihren ausgedehnten Wäldern, den
moosbewachsenen Bäumen, besitzt schon deutlich größere Reize
als der baumlose Norden. Bei Rio Grande, das am
 Meer liegt,
überqueren wir den gleichnamigen Fluß. Die Piste führt
zunächst am Ufer des Sees entlang, ehe sie sich dann zum
Garibaldi-Paß aufschwingt, von dem man einen majestätischen
Tiefblick auf den Lago Escondido hat. Jenseits des Passes
eröffnen sich zunehmend schönere Blicke auf die bizarr
geformten, schneebedeckten Gipfel der Darwin-Kordillere.
Meer liegt,
überqueren wir den gleichnamigen Fluß. Die Piste führt
zunächst am Ufer des Sees entlang, ehe sie sich dann zum
Garibaldi-Paß aufschwingt, von dem man einen majestätischen
Tiefblick auf den Lago Escondido hat. Jenseits des Passes
eröffnen sich zunehmend schönere Blicke auf die bizarr
geformten, schneebedeckten Gipfel der Darwin-Kordillere.
Die Täler sind von Torfmooren und Sümpfen überzogen, die,
ockergelb und rötlich-braun, fast kreisförmig schwarze
Wasserflächen umschließen, was der Landschaft diesen ganz
besonderen Reiz verleiht. Schon bald wird der Blick frei auf
den Beagle-Kanal, der Feuerland in zwei Teile teilt und noch
wesentlich schmaler ist als die Magellanstraße. Zwischen
jenen hohen Bergen hindurch segelte später Kapitän FitzRoy
durch diese Meerenge, mit dem Forschungsschiff Beagle – an
Bord der berühmte Naturforscher Charles Darwin. Darwin, dem
Vater der Evolutionstheorie, zu Ehren erhielt die
Darwin-Kordillere seinen Namen sowie deren höchste Erhebung,
der 2488 m hohe Mount Darwin.
Ein Thema, das man nicht aussparen kann, weil man als
Reisender immer wieder damit konfrontiert wird, sind die
Umweltschäden, die auch diesen Teil der Welt nicht verschont
haben. Zumeist handelt es sich um Abholzungen aus der
Brandrodung. So liegen beispielsweise noch heute die
Baumstümpfe der Rodungen ehemaliger Kolonisatoren zu Zeiten
der Landnahme dort, wo sie gefallen sind.
Pistenverbreiterungen, bei denen ganze Bergstöcke
abgesprengt wurden, haben häßliche Spuren in der Landschaft
hinterlassen. Waren die schmalen und kurvenreichen, sich dem
Gelände anpassenden Straßen noch halbwegs malerisch und kaum
störend, so hinterlassen die begradigten, autobahnähnlich
ausgebauten Trassen dramatische Erosionen und Hangrutsche.
Auch die Überweidung hat ihre Spuren hinterlassen.
Bekanntlich wählen Schafe stets die gleichen Pfade, so daß
die Steilhänge aussehen, als wären sie von einem künstlichen
Wegenetz überzogen.
Aus wirtschaftlichen Erwägungen betreiben die Regierungen in
Santiago und Buenos Aires eine Rodungspolitik, die den
Indígenos, denen dadurch die Lebensgrundlagen entzogen
werden, nicht paßt und die darum von ihnen mit
Vergeltungsschlägen geahndet wird. Nicht nur, daß die
Eindringlinge Menschen und Tiere ausrotteten und die
Landschaft zerstörten, haben sie auch Parasiten und fremde
Tier- und Pflanzenarten eingeführt, die die ursprüngliche
Flora und Fauna verfälschten. So sind unsere heimischen
Karnickel und Biber, die sich dort ungemein verbreitet und
das ökologische Gleichgewicht erheblich gestört haben,
bereits zur Plage geworden und müßten eigentlich bejagt und
wieder ausgerottet werden.
Nach mehr als 1.000 Kilometern Einsamkeit erreichen wir
schließlich unser ersehntes Ziel, die Stadt Ushuaia. Sie
nimmt, abgesehen von den unangenehmen Begleiterscheinungen
einer jeden Großstadt, eine malerische Lage ein, an einer
Ausbuchtung des Beagle-Kanals gelegen, umrahmt von
majestätischen Bergen mit spektakulären Gipfelformationen.
Sie wird nahezu ausnahmslos von allen Kreuzfahrtschiffen
angelaufen, und nicht selten sieht man auch einen Eisbrecher
hier liegen. Außerdem ist Ushuaia, das seinen indianischen
Namen beibehalten hat, Ausgangsbasis für Segeltörns um Kap
Hoorn, den südlichsten Punkt des südamerikanischen
Subkontinents, und in die Antarktis. Diese bzw. die ihr
vorgelagerten Süd-Shetlandinseln sind von hier aus nur ca.
500 Seemeilen entfernt. Die Antarktis ist das größte
Süßwasserreservoir der Erde und zugleich deren Windmaschine.
Daher kann es um Kap Hoorn bei Winden, die aus Süden wehen,
zu schweren Stürmen kommen, und dennoch wurde von den alten
Seefahrern häufig der längere Weg um das Kap der
Durchquerung der Magellanstraße vorgezogen.
Auch das Inselgewirr des Nationalparks Alberto De Agostini
mit seinen Fjorden ist für Segelfreunde ein wahrer Traum,
uns hingegen muß eine Fahrt auf dem Beagle-Kanal vorerst
genügen. Von Ushuaia aus kann man Ausflugsfahrten zu einigen
kleinen Felseilanden unternehmen, wo sich Robben- und
Vogelkolonien niedergelassen haben. Die Tiere unterscheiden
sich in ihrer Färbung kaum von dem Gestein, auf dem sie
träge herumliegen, und es geht ein bestialischer Gestank von
ihnen aus. Auch Magellan-Kormorane und Fregattvögel leben
hier zuhauf. Die Berge des Beagle-Kanals im Hintergrund,
ergeben sich dort ganz reizvolle Fotomotive.
Die Ausflügler stammen meist von einem der hier liegenden
Kreuzfahrtschiffe, diesen schwimmenden Krematorien, von
denen weithin Leichengeruch ausgeht, und sie benehmen sich
wie Kinder, diese Kreuzfahrer, wenn sie Seehunde oder
Pinguine vor die Linse bekommen. Haben sie doch den letzten
Zoobesuch oder Zirkusaufenthalt, wo sie die Tiere noch vor
kurzem sahen, schon wieder vergessen! Wie vom Fieber
gepackt, rennen sie sich gegenseitig über den Haufen und
treten einander fast tot. Es ist schon ein wenig
befremdlich: Die Menschen bringen alles um und rotten alles
aus und erfreuen sich dann des wenigen, das noch
übriggeblieben ist.
Der Vogelreichtum des Beagle-Kanals ist schier
unerschöpflich. Die ganze Luft ist erfüllt mit Schwärmen von
Seeschwalben. So muß die Natur einst überall ausgesehen
haben, ehe der Mensch in seinem Jagdeifer daranging, die
Arten zu dezimieren. Man ist versucht, sich die Zeiten
Darwins herbeizuwünschen, der die Natur noch unverfälscht
erleben durfte, ohne die stickige Hitze derer, die aus
Jägern und Sammlern hervorgegangen zu dem geworden sind, was
sie heute sind, zu einer Plage für den Planeten. Viele von
denen, die hier ihre Kamera zücken, wissen noch nicht
einmal, was sie vor sich haben.
Auch in den überfüllten Straßen der Stadt drängen sich
überall nur Kreuzfahrtpassagiere, zwängen sich durch die
Lokale und übervölkern die Museen oder geben ihr Geld für
Kitsch in den Souvenirläden aus. Die Stadt kann mit dem
Andrang kaum fertig werden, zwar gibt es reichlich
Restaurants, doch an Cafés fehlt es völlig.
Wir verlassen nun Ushuaia, das Ende der Welt, an einem
grauen Morgen. Die Launen des Wetters sind wirklich
unerträglich, so daß uns der Abschied nicht schwerfällt. Da
der Wind heute aus Osten weht, starten wir auch nach Osten,
fliegen ein Stück über den Beagle-Kanal, bis wir genügend
Höhe gewonnen haben, und schwenken dann über der
Darwin-Kordillere ab nach Norden, Richtung Buenos Aires, der
Hauptstadt Argentiniens. Lange noch werden uns die
vergangenen Wochen, die wir buchstäblich auf der
Panamericana zugebracht haben, in Erinnerung bleiben: die
bläulichen Gletscher des Perito Moreno, die milchig-grünen
Wasser des Lago Argentino, die ausgedehnten, kaum berührten
Wälder und die windigen, wildzerzausten Bergspitzen
Feuerlands. Doch wir werden wiederkommen, uns das zu
erobern, wonach uns schon seit langem gelüstet, das letzte
Paradies auf Erden, die blendend-weiße Antarktis.
Copyright © 2002, Manfred
Hiebl. Alle Rechte vorbehalten.